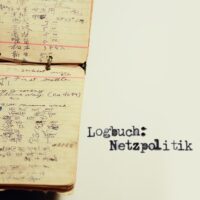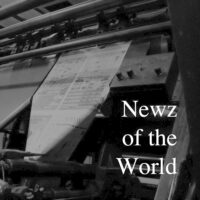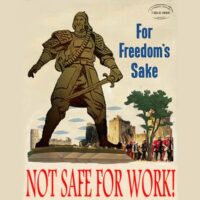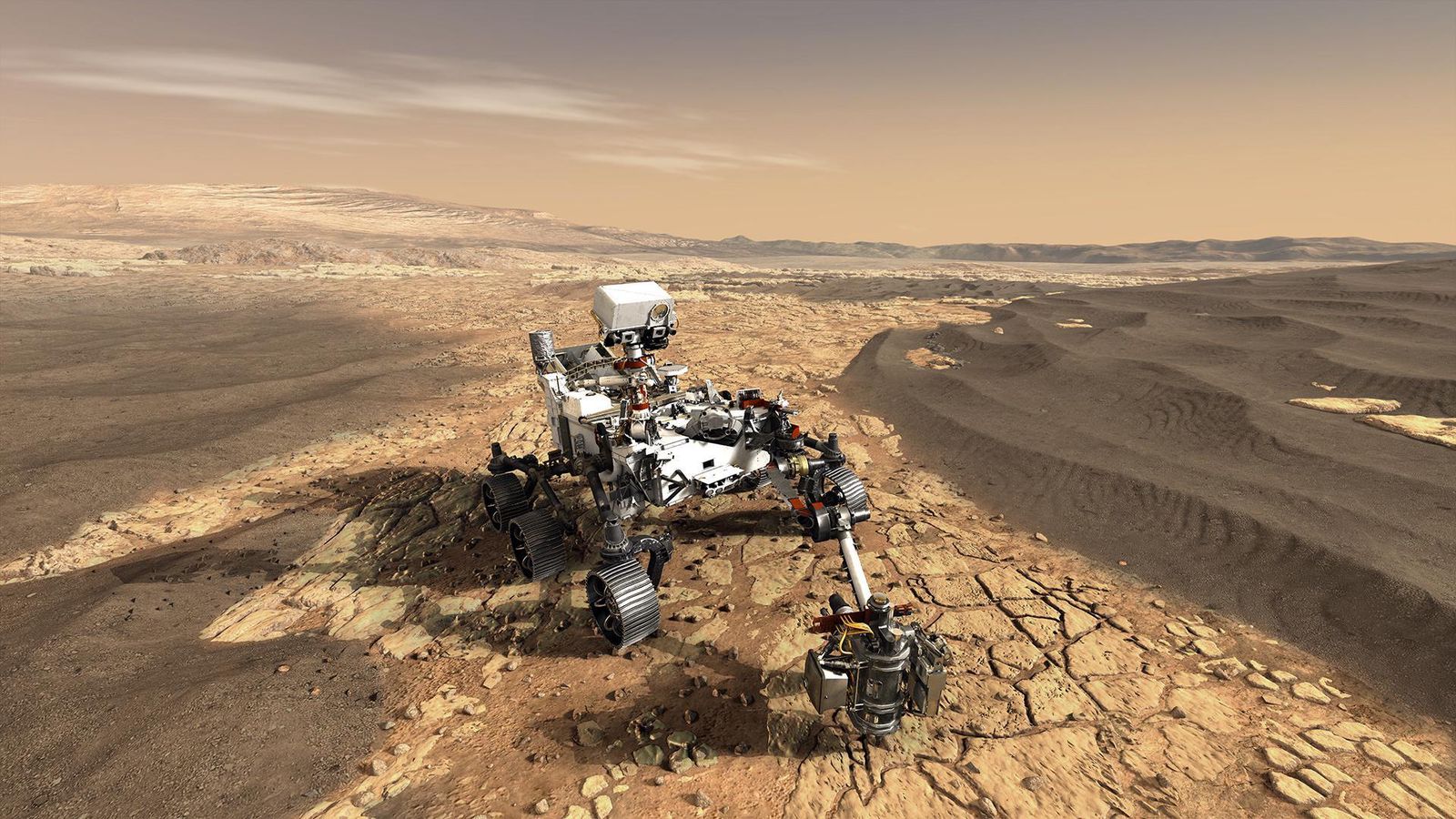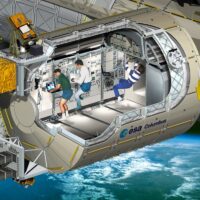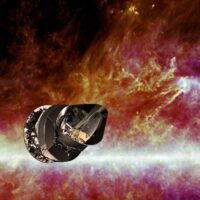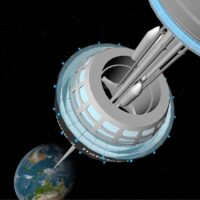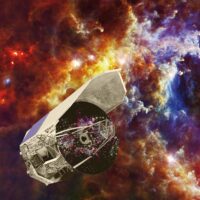Die Mission Hayabusa 2 und der Lander MASCOT besuchen den Asteroiden Ryugu
Die Fortsetzung der Hayabusa-Mission der japanischen Weltraumagentur JAXA führt eine Raumsonde zum Asteroiden Ryugu. Mit an Bord ist der Lander MASCOT, der vom Institut für Raumfahrtsysteme des DLR in Bremen entwickelt wurde. Die Mission verläuft außerordentlich erfolgreich und befindet sich derzeit auf dem Rückflug zur Erde.
Dauer:
2 Stunden
3 Minuten
Aufnahme:
15.01.2020

Tra-Mi Ho
|
Wir sprechen mit Tra-Mi Ho, Projektleiterin des Landers MASCOT über die Gründe für Missionen zu Asteroiden, die Erfahrungen der ersten Hayabusa-Mission, den Planungen für die Nachfolge-Mission, die Anforderungen an die Lander-Module der Mission, den Verlauf der Landung von MASCOT und die Massnahmen, die erforderlich waren, um den Lander korrekt in Betrieb zu nehmen, welche Daten gesammelt werden konnte und welche Erkenntnisse aus der Mission voraussichtlich generiert werden konnten.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript
mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert.
Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern.
Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort.
Formate:
HTML,
WEBVTT.
Transkript
Tim Pritlove 0:00:34
Hallo und herzlich willkommen zu raum zeit dem podcast über raumfahrt und andere kosmische angelegenheiten mein name ist Tim Pritlove und ich begrüße alle zum neuen jahr zwanzig zwanzig das die erste sendungdie ich in diesem jahr aufnehme,der reigen lustiger themen abfolgen geht hier natürlich weiter und heute blicken wir auf ja,kleine unbekannte objekte im weltall und warum die denn eigentlich so interessant sind konkret geht es um asteroiden wir hatten ja schon mal eine sendung wo es spezifisch um asteroiden und kometen,als solche ging heute allerdings schon wieder drauf aus der perspektive,einer mission konkret der zwei mission,ja und dazu bin ich nach bremen gefahren zum institut für raumfahrttechnik des,dr und begrüße meine gesprächspartnerin ramiro schönen guten tag frau sie sind hier,als.Jetzt muss ich kurz nochmal nachdenken leiterin der mascot mission im rahmen der hayabusa zwei mission aufgestellt das ist richtig ne.
Tra-Mi Ho 0:01:52
Ja das ist richtig.
Tim Pritlove 0:01:54
Und zwei ist eine premiere japanische mission zu einem asteroiden darüber werden wir gleich noch viel sprechen,zu beginn würd mich natürlich erst mal interessieren wie sie eigentlich zu raumfahrt gekommen sind warum.
Tim Pritlove 0:02:15
Hätte doch auch viele andere schöne sachen machen können im leben.
Tra-Mi Ho 0:02:18
Das stimmt ja,ich bin von der ausbildung her bin ich physikerin ich habe physik studiert schon aus überzeugung natürlich ähm.
Tim Pritlove 0:02:33
Manche machen das auch wenn ihr nichts besseres eingefallen ist.
Tra-Mi Ho 0:02:35
Ich muss zugeben ich habe gewürfelt.
Tim Pritlove 0:02:38
Einzige okay zwischen.
Tra-Mi Ho 0:02:40
Medizin und physik ja genau aber letztendlich habe ich mich doch dann für die physik entschieden,und,mich auf astrophysik konzentriert habe meine doktorarbeit dann im bereich kometen,habe ich absolviert und bin dann durch mehrere stationen dann an das den er hier in bremen angekommen.
Tim Pritlove 0:03:11
Wo war das studium ursprünglich.
Tra-Mi Ho 0:03:12
Also meine doktorarbeit habe ich in bern absolviert und bin danach dann zuerst.Nach holland genau bei der esa war ich dann und nach drei jahren bei den holländern habe ich dann gedacht möchte ich wieder zurück nach deutschland.
Tim Pritlove 0:03:34
Und dann fiel die wahl auf bremen.
Tra-Mi Ho 0:03:35
Dann fiel die wahl auf bremen es gab ein neues institut das institut für raumfahrt systeme hieß es oder heißt es immer doch.
Tim Pritlove 0:03:43
Ich habe kaum fahrtechnik gesagt ne raumfahrt systeme ist.
Tra-Mi Ho 0:03:46
Raumfahrt systeme genau und mich hat das überzeugt beim interview wurde mir gesagt hier wird noch hands on alles gemacht hier dürfen sie ihre hand auf richtige hardware legen.Nicht nur studieren nicht nur powerpoint präsentation.
Tim Pritlove 0:04:07
Was wird denn das institut für raumfahrt systeme aufgestellt also was ist denn hier sozusagen eigentlich der zentrale bereich an dem gearbeitet wird hier.
Tra-Mi Ho 0:04:15
Zwanzig haben wir drei säulen.Fangen wir immer dazu das eine ist dass wir analysieren wir analysieren haben theme es umfasst nicht nur kleineroboter auf kleinen körpern sondern es kann auch sein satelliten,wir haben hier auch eine satellitenbild von gestartet letztes jahre gruppen ähm nein gestartet ist es sogar das jahr davor,war sozusagen inbetriebnahme dann letztes jahr.
Tim Pritlove 0:04:53
Muss man erstmal den jahreswechsel.
Tra-Mi Ho 0:04:55
Genau eben ich bin noch in zwotausendneunzehn.
Tim Pritlove 0:04:58
Da sind wir alle.
Tra-Mi Ho 0:04:58
Ja und dann wir haben auch wir forschen auch an orbitalstation systemen,auch diese dinge analysieren wir und das ist die systeme löse dann tun wir auch ähm technologien entwickeln.Das da haben wir die an denen wir forschen oder auch jeans systeme an denen wir forschen hier im institut.
Tim Pritlove 0:05:27
Das ist was.
Tra-Mi Ho 0:05:28
Das sind alles systeme die mit dem herz sozusagen eine satelliten oder eines landes zu tun hat ähm es handelt sich hierbei um den bordcomputerum die kommunikation die antennen auch um das power system,all diese systeme die dann sozusagen.
Tim Pritlove 0:05:52
Essentiell sind.
Tra-Mi Ho 0:05:53
Essenziell sind genau.
Tim Pritlove 0:05:55
Jens hier steht dann für guidance navigation control also die ganze steuerung orientierung im raum etcetera.
Tim Pritlove 0:06:04
Ja das heißt hier wird richtig erfunden sozusagen gebaut und gelötet.
Tra-Mi Ho 0:06:08
Genau.Das sind die einzelnen technologien aber wir machen dann auch wir entwickeln natürlich dann auch das system selber das heißt wir analysieren nicht nur die machbarkeit zum beispiel sondern wir entwickeln dann an den systemendazu gehört ein messgerät ist ein system es besteht aus vielen subsystemen oder auch,kropes das hat lieb oder auch andere systeme die hier entwickelt werden und äh da haben wir das system engineering sozusagen hier im haus als eine der wichtigsten kompetenzen,die projektentwicklung.
Tim Pritlove 0:06:50
Sollte man auch nicht unerwähnt lassen nebenan ist ja das zahn mit dem schönen fall turm das heißt wenn man dann was schönes gebaut hat dann kann man dann auch gleich schon kaputt machen und aus hoher höhe fallen lassen.
Tra-Mi Ho 0:07:01
Ja nicht nur beim zahn wir haben hier auch ein labor gebäude dort ähm unterlaufen die ganze systeme dann die tests die ganzen qualifikations test um sozusagen das system dann startklar zu machen für die mission denn.
Tim Pritlove 0:07:14
So ein kleines sozusagen so ein.
Tra-Mi Ho 0:07:17
Es ist ein kleines ein testzentrum.
Tim Pritlove 0:07:20
Aber der fall turm wird dann auch genutzt.
Tra-Mi Ho 0:07:22
Der fall turm wird genutzt wenn es relevant sein sollte für das projekt das war es für messgerät da haben wir dann die separation des landes vom mutterschiff haben wir dort getestet,um zu schauen ob das auch funktioniert weil das eines der schlimmsten dinge die passieren kann nicht nur für uns sondern auch für unsere japanischen kollegen ist dass sie wieder,ja zurück zur erde mitfliegen mit wieder mitbringen müssten wenn die separation nicht geklappt hat oder das,hängt so zusammen dann noch irgendwo dran.
Tim Pritlove 0:07:54
Irgendwas kann immer schief gehen ja.
Tra-Mi Ho 0:07:57
Genau ja.
Tim Pritlove 0:07:59
Also messgerät ist der länder der also einer der länder die in dieser hayabusa zwei mission,zum einsatz gekommen sind da werden wir gleich nochmal im detail drauf eingehen.Jetzt stellt sich natürlich die frage was macht eigentlich asteroiden mission so interessant was was verfolgt die wissenschaft derzeit für ziele warum,kriegen diese mission den zuspruch und die finanzierung und die durchführung derzeit was was sind die unbekannten die man jetzt hier ausforschen möchte.

Tra-Mi Ho 0:08:37
Also es gibt meiner meinung nach drei große beweggründe warum man asteroiden unter unbedingt studieren möchte,und das eine istder wissenschaftliche ansatz wir möchten natürlich etwas mehr wissen oder wir wollen natürlich verstehen wie das sonnensystem aufgebaut ist und dazu gehören asteroiden als eines der elementaren bausteine also die asteroiden,sind vielleicht bauteile der planeten gewesen abersind letztendlich dann als asteroiden geblieben und solche dinge möchte man natürlich diese dieses rätsel der entwicklung unseres sonnensystems da erhoffen wir natürlich durchmehr informationen zu den asteroiden zu ihrer zusammensetzung zu wo der chemischen wie auch der,physikalischen dann mehr informationen bekommen um dann auch die ganze entstehung des sonnensystems zu verstehen das ist,der wissenschaftliche teil der zweite aspekt ist dass asteroiden natürlich auch eine gefahr darstellen für die erde.Gab in der vergangenheit asteroiden einschläge auf der erde aber nicht nur auf der erde auch auf sämtlichen planeten oder auch mondmäßig sie das sehen sie hier die,muss man ja nur die genau muss man ja nur auf die oberfläche schauen und das könnte natürlich eine gefahr sein wenn da ein asteroid einschlagen sollte er muss nicht mal groß seinalso es kann auch nur ein teil eines asteroiden sein und da habe ich auch kürzlich einen vortrag dazu gehört eskann ja weniger als ein meter sein und trotzdem schon sehr sehr viel schaden,und wir haben das auch am beispiel dieses dieses chilli einschlagen gesehen wo ein meteorit eingeschlagen ist ein fireball oder feuerball,und da sind auch innerhalb dieser stadt sind gab es unglaublich viele schäden.
Tim Pritlove 0:10:45
Das war im februar zwanzig dreizehn also jetzt sieben jahre her knapp da gab es ja dann auch schon viele videos,vor allem weil so viele immer mit kameras in ihren autos herumgefahren sind und gab,zerplatzte scheiben entsprechende schäden und bedrohung dadurch merkte vor allem auch diese immense sprengkraft wie so eine vergleichsweise kleinerastrid also man sagt ja dann meteor wenn er runterkommt hat einfach durch das auftreffen auf die atmosphäre durch die hitze bildung wenn dann alles auseinander fliegt das jetzt einfach energien frei die man sich sitzt soerstmal gar nicht vorstellen kann und es gibt ja auch ganz klassische das tun goshka,ereignis wird glaube ich auch einem asteroiden zugeschrieben dass jetzt hundert jahre her ein bisschen mehr,offensichtlich ein ein sehr viel größeres objekt heruntergekommen ist und wälder platt gemacht hat etcetera.
Tra-Mi Ho 0:11:41
So ist das und wir wollen nicht hier über die dinosaurier reden.
Tim Pritlove 0:11:45
Wobei die hätten da sicherlich auch noch was sozusagen.Ja gut also astrid können eine gefahr sein ist natürlich immer so ein bisschen so eine abstrakte geschichte da sagen wir die politiker wahrscheinlich so ach jetzt kommt die wissenschaftler wieder hier mit ihrer gefahr und so die wollen ja nur mehr geld haben,aber es ist vielleicht unwahrscheinlich aber ich denke wenn man diese risiko abschätzung macht mit so ja es mag vielleicht,unwahrscheinlich sein aber wenn's passiert dann ist gleich so richtig unangenehm.
Tra-Mi Ho 0:12:18
So ist das und es geht glaube ich auch hier vor allem vor allem um die fragestellung wie frühkönnen wir denn solche möglichen gefahren schon erkennen dass sie unwahrscheinlich sind ich glaube dassuns natürlich hoffnung ein bisschen besser zu schlafen aber wenn es denn passieren sollte muss man zu früh wie möglich agieren,asteroiden einschläge die je nachdem wie klein diese teile sind umso später können sie entdeckt,und dies ist auch dieses frühwarnsystem ist dann so wichtig und da muss man eben verstehen wie,groß wie klein wie sind sie zusammengesetzt solche fragestellungen muss man dann beantworten.

Tim Pritlove 0:13:06
HmDas war ja hier auch schon mehrfach thema weil bei raum zeit vielleicht mal kurzer verweis für leute die ganz gerne auch mal zurückhören ausgabe einundsiebzig hatte ich mich mit rüdiger jenen konkret über die frage der asteroiden abwehr unterhalten was da so für kataloge geführt werden wie die risiken so eingeschätzt werden wir da noch mehr hören möchte,kann da mal rein horchen ich denke vor allem ist es aber die die wissenschaftliche frage die natürlich jetztdiese mission drückt und die frage der gefahrenabwehr ist so quasi nochmal so ein abfallprodukt weil umso besser man das kennt umsonäher man dran war umso mehr man darüber weiß wie sind die aufgebaut wie muss man die dann handhaben wenn's denn vielleicht wirklich mal so ein problem wird,das sind alles immer so ganzbreite erkenntnisse die man dabei gewinnen kann aber vor allem ist es eben so diese diese kernvorschläge jung die die die grundlagenforschung dieses verstehen wollenwo kommt denn das jetzt hier weil ich meine asturien gibt's ja eine menge masterinnen gürtel gibt's keine ahnung ob es eine sinnvolle schätzung gibt wie viele objekte dort unterwegs sind da sind die eigentlich auch,schön dass die weit weg sind aber ab und zu kommt ja dann doch nochmal einer vorbei und diese kategorie dieser erdnahenasteroiden die tun uns ja jetzt auch den gefallen dass sie dann eben ab und zu auch mal so nah rankommen dass man eben die gelegenheit nutzen kann auch mal vorbei zu fliegen.
Tra-Mi Ho 0:14:36
Genau man kann natürlich mit einem geringen delta wie das ist mehr oder weniger die aufwands abschätzung in der raumfahrt dann ähm zu diesem erdnahen asteroiden fliegen.
Tim Pritlove 0:14:50
Also die geschwindigkeit relative geschwindigkeit des asteroiden zu erde.
Tra-Mi Ho 0:14:55
Zur erde genau und das ist natürlich für erdnähe asteroidenbedeutet das auch dass wir weniger treibstoff brauchen um dorthin zu kommen und das macht natürlich auch so eine mission dann günstiger umso mehr man treibstoffbraucht umso mehr muss man mitschleppen umso mehr masse hat man und umso mehr kostet dann auch diese mission.
Tim Pritlove 0:15:23
Raketen sind erforderlich etcetera.
Tim Pritlove 0:15:26
Was war denn so die ersten missionen die wirklich jetzt zu asteroiden geflogen sind erfolgreich und die uns dann schon erste erkenntnisse gebracht haben.
Tra-Mi Ho 0:15:35
Die ersten missionen also ich würde sagen eine der bedeutenden asteroiden mission ist die schuhmaker mission,der nasa die ist zum asteroiden geflogen hat den kartografiert und,dann als der treibstoff dann zu ende war auch auf dem asteroiden gelandet mehr oder weniger ziemlich sanft.Eine andere mission war die mission,die berühmte bruscetta mission bevor sie zum kometen schulhof grass gelangt ist flug sie an zwei asteroiden vorbei,ein astrid ist und dann restauriert lucia da gab's ja auch spektakuläre bilder,vor allem dann von lucia sehr hoch aufgelöstes bilder die eine oberfläche zeigten die wirklich also,unterschiedliche ich würde sagen merkmale auf der oberfläche die ja,unterschiedliche geologische merkmale hatte und die.
Tim Pritlove 0:16:55
War da so so abwechslungsreich also ich meine wenn ich da so auf das bild draufschaue siehst du ein paar krater und ansonsten viel grau.
Tra-Mi Ho 0:17:01
Ich glaube das sieht man meistens.
Tim Pritlove 0:17:03
Ja aber was was könnte man daraus lesen.
Tra-Mi Ho 0:17:07
Da muss ich aber nochmal die bilder genau anschauen aber es gab soweit ich mich erinnern kann doch,viel mehr an aktivitäten auf der oberfläche zu erkennen als man gedacht,weil normalerweise geht man davon aus es handelt sich hier um tote körper sozusagen im himmel da passiert,aber soweit ich das von den kollegen mitbekommen habe ähm ist es so dass es erstmal unterschiedliche oberflächen gibt mit unterschiedlichen merkmalen,auch dass es zu einem art gefälle gekommen ist zu einer bewegung der oberfläche,aber was da genau passt dann als interpretation dann rausgekommen ist müsste ich nochmal nachschauen.
Tim Pritlove 0:17:56
Okay aber auf jeden fall war das ein erkenntnis gewinnen auch wenn man jetzt nicht drauf gelandet ist einfach das genauer hinschauen und vor allem eben diese hochauflösende kameras diebei rosetta an bord waren und sind auch noch andere dinge newtonmeter et cetera zum einsatz gekommen alles was irgendwie,man sich leisten konnte in dem moment dafür strom zu verbrauchen.
Tra-Mi Ho 0:18:16
Jagenau ja und dann haben wir natürlich die mission da muss man immer unterscheiden viele sagen dazu heia buße eins aber es ist an sich die haie mission.
Tim Pritlove 0:18:29
Muss man doch nicht dass eine zweite gibt.
Tra-Mi Ho 0:18:30
Damals wusste man nicht dass es eine zweite gibt,die hat ja zum ersten mal auch asteroiden proben zurückgebracht zu erde und das war schon spektakulär so etwas gab's davor noch nicht.
Tim Pritlove 0:18:48
Schauen wir doch nochmal ein bisschen auf diese erste mission weil ja im prinzip die grundlage der zweiten mission ist ganz klar also ist zweitausenddrei gestartet die mission war dann sieben jahre später oder acht jahre später zwanzig zehn,abgeschlossen seine mission wie auch jetzt der nachfolger primär von von der japanischen,raumfahrt organisation geführt von der nasa weiß man irgendwie viel,von der esa weiß man in der öffentlichkeit meist schon weniger wer raum zeit hört was eine menge über die elsa ist so ein bisschen,sommer in unserem kosmos ein wenig unbekannter worauf worauf spezialisieren sich die japaner was was ist so ihr ansatz und,können sie irgendwas dazu sagen,ein anderer stil herrscht oder ob ob es eigentlich nur dasselbe in grün ist was dort gemacht wird wie muss man darauf blicken auf die axa.

Tra-Mi Ho 0:19:53
Also,ich selber hatte auch vorher natürlich nur von der mission gehört wenn man sich das so anschaut dann denkt man sich wirklich von der jan hat man wenig man fragt sich natürlich auchliegt das auch einfach nur daran dass man die japanischen zeiten nicht lesen konnte einfach,ist ein bisschen schwieriger als bei der nase nach zu blättern da sieht man da holt man sich viel mehr an inhalten raus als bei der jagd und auch ich glaube dass in den letzten jahren die jackesehr,sich auch darum bemüht auch dem internationalen publikum etwas zu bieten da sieht man auch schon jetzt wenn man sozusagen die englischen zeiten sieht und das war wahrscheinlich vorher nicht gewesen.Als ich dann am,mit der zwei mission angefangen habe oder angefangen habe da involviert zu sein wurde mir dann auch eine richtige roadmap vorgestellt also die hatten einen plan,die wussten sozusagen genau also das was man vielleicht nicht lesen kann weil man vielleicht nicht die information,verstehen kann oder bekommen kann das hatte sich dann in diesem vortrag dann wirklich gezeigt,materialisieren also sie hatten eine roadmap und es war geplant dass es eine hayabusa mission gibtund eine zwei mission und dass die jagd gerade im bereich der kleinen körper gerne sagen wir mal,alle asteroid klassen besuchen möchte.
Tim Pritlove 0:21:40
Also sie selbstgewählte spezialisierung einfach weil man gesehen hat das machen die anderen nicht so oder hat die das besonders interessiert oder gibt's da irgendwas in der japanischen raumfahrt tradition was so darauf hingeführt hat.
Tra-Mi Ho 0:21:55
Da müsste ich natürlich noch viel mehr nachfragen was jetztwirklich die hintergründe sind wissenschaftlich kann ich mir vorstellen dass es natürlich sehr interessant ist wie gesagt ich meine kleine körper asteroiden sie schlagen nicht nur auf die erde ein sie sind nicht nurteil des sonnensystems sondern vielleicht auch dieses puzzlestück was sozusagen wasser oder organischeelemente auf unsere erde gebracht hat aufgrund dessen dass sie auch auf die erde,aufgeschlagen sind das ist der wissenschaftliche teil 'ne andere an andere grund kann auch sein dass gerade durch die untersuchung von erdnahen asteroiden was technologisch,machbare ist für ich möchte nicht sagen wenig geld aber letztendlich doch machbare als wenn man wirklich dann in die weiten unendlichen,welten des weltalls fliegt das ist natürlich vielleicht machbare so kleine.
Tim Pritlove 0:23:00
Kleine.
Tra-Mi Ho 0:23:02
Mission zu kleinen körpern zu entwickeln und ich glaube das spielt vieles mit,was die beweggründe der unterstützt hat dann zu sagen okay wir spezialisieren uns auf kleine körper auf asteroiden,gesehen davon das andere ist vielleicht weniger gemacht haben.
Tim Pritlove 0:23:20
Ja okay dann schauen wir doch mal was die busse mission so losgetreten hat also es wurde das lied gebaut.Das ziel war der astrid.Also auch noch mit japanischen namen haben die dir dann auch gefunden sozusagen und benannt vorher und dann gesagt so da muss man jetzt mal hin weil das war ja dann wahrscheinlich auch so ein ordner astrid der vielleicht noch gar nicht so lange bekannt war vorher.
Tra-Mi Ho 0:23:48
Weiß ich nicht ob der nicht schon seinen namen hatte bevor die mission dann den asteroiden besucht hat bei rico ist es wirklich so gewesen dass er ruhig gut dann danach benannt wurde dann nachdem die mission schon,gestartet ist.
Tim Pritlove 0:24:03
Aha also war ist ja der begründer des japanischen weltraumprogramm.
Tim Pritlove 0:24:11
Nicht ganz nicht irgendein name.
Tra-Mi Ho 0:24:14
Nicht irgendein name genau und wenn man weiß wie asteroiden benannt werden dass man sucht sich natürlich auch die leute aus die dann etwas für die raumfahrt getan.
Tim Pritlove 0:24:26
Ich bin grad mal geschaut also das tatsächlich erst achtundneunzig entdeckt worden also fünf jahre bevor.
Tim Pritlove 0:24:31
Gestartet hat das natürlich lässt schon mal drauf schließen dass man.Eigentlich dabei war eine mission zu planen aber noch gar nicht genau wusste wo es hingehen soll,das kommt ja gerade in mode habe ich so den eindruck dass man sehr dynamisch reagiert nicht wahr dass bei so zum beispiel,habe ich ja hier auch neulich bei raum zeit ein gespräch darüber geführt,also sollte es sein und die mission wurde dann zweitausenddrei gestartet und ist ja auch.Nicht ohne probleme gelaufen wenn ich das richtig sehe es gab.
Tra-Mi Ho 0:25:16
Bis zum asteroiden ging das noch ganz gut am asteroiden fingen dann meine meinung.
Tim Pritlove 0:25:23
Schon so das vorher schon sonnenstürme ein problem war und schon so den ganzen.
Tra-Mi Ho 0:25:28
Die elektronik oder.
Tim Pritlove 0:25:31
Ich weiß nicht ganz genau was ist richtig sehr sind irgendwie solarpanel so ein bisschen unter beschuss gekommen oder die energieversorgung sodass nicht ganz so schnell geflogen werden konnte wie es ursprünglich geplant war.
Tra-Mi Ho 0:25:43
Ja das kann sein davon hab ich nicht.
Tim Pritlove 0:25:46
Aber es hat auf jeden fall geklappt da sind dort gekommen und da kam ja auch schon eine erste landeten zum einsatz die auch glaube ich in japan entwickelt wurde.
Tra-Mi Ho 0:25:56
Wie man ja genau das hätte der erste rover sein sollen der auf einem asteroiden landen sollte,aber leider hat es nicht geklappt,er ist verloren gegangen in dem sinne dass die separation natürlich geklappt hat aber die landung nicht.
Tim Pritlove 0:26:21
Timing nicht hingehauen hat.
Tra-Mi Ho 0:26:23
Nicht weil das timing nicht hingehauen hat sondern weil das gravitations feld nicht richtig bestimmt wurde,oder nicht richtig bestimmt werden konnte und entsprechend ist minerva dann wieder also wieder,es hat ja nicht die oberfläche irgendwie berührt sondern es ist vorbei geflogen und ist dann verloren gegangen.

Tim Pritlove 0:26:46
Weil das das ist ja sozusagen das problem man hat es mit so einem kleinen objekt zu tun.Dass man bestenfalls ein teleskop als kleinen grauen punkt sieht und man kann es halt lange beobachten und dann sieht man so ah okay alles klar eben war da noch da jetzt ist er da bahn bestimmung geschwindigkeitalles kein problem das kriegt man relativ genau hin so dass man da eben auch hinfliegen kann aber wenn man erstmal da ist dann ist ja so der unterschied mit dann bist du jetzt einen kilometer im durchmesser oder vielleicht dann dochzwei man weiß es nicht genau und das hat ja damals auch immer noch nicht genau sagen kann was weiß ich drin sind so und so masse reich weil,klar vielleicht hört man's bei einem mal bestimmt aber es heißt ja nicht dass der andere dann genauso ist muss man das alles vor ort,eigentlich erst feststellen das heißt man muss dort messungen vornehmen,und überhaupt erstmal bestimmen ok mit was haben wir es denn jetzt hier zu tun und dann quasi seine landeplätze daran anpassen.
Tra-Mi Ho 0:27:45
So ist das und auch weil es so kleine körper sind haben sich sehr.Unregelmäßige formen das heißt das gravitationswellen kann sich ja auch variieren über den asteroiden hinweg,am anfang nimmt man natürlich einen runden asteroiden an aber wenn man da ankommt und gerade bei edeka war ist das ja eher mehr so ein länglicher asteroid da kann sich auch das gravitationswellen sich dann auch verändern je nachdem wo manabsetzen möchte und wenn man das nicht genau bestimmt und auch dann vielleicht nicht die richtige,erreichen kann dann passiert es dass dann ähm die separation sozusagen schiefgehen kann.
Tim Pritlove 0:28:29
Ja also wie ungewöhnlich dass sein kann hat man ja auch bei bei der rosetta mission gesehen damit humor mango der siebenundsechzig p der auch,sehr überraschend aussah,zwei aneinander geklebt e teile vermutlich weiß ich nicht genau wie weit man da mit der forschung schon ist aber sah zumindest jetzt nicht aus als wäre es so aus einem ei gepellt worden und dementsprechend verteilt sich natürlich dann die gravitation extrem kompliziert und es macht auch die,schwer.
Tra-Mi Ho 0:28:57
Über den körper verteilt es sich und je nachdem wie man sozusagen die vorbeiflügeplant kann man auch entweder gut oder ein bisschen mit schlechterer auflösung die gravitation bestimmen rosetta war inim orbit,machte der mission ist leichter die gravitation des ganzen körper im laufe der zeit zu bestimmen bei der mission ist es so dass das mutterschiff,ich sage immer das mutterschiff dazu dann in einer konstanten distanz zum asteroiden mitgeflogen ist das nennt man huber ring,dadurch rotiert der astrid natürlich immer unter dem raumschiff aber.
Tim Pritlove 0:29:47
Man kriegt nur eine achse.
Tra-Mi Ho 0:29:48
Man bekommt wahrscheinlich nur eine achse je nachdem in welcher position man isst und da braucht man zeit natürlich um wirklich dann das ganze gesamte gravitationswellen zu bestimmen und,wenn aber die separation des lenders auch zeitkritisch sein könnte oder weil man man möchte natürlich immer ein länder absetzen bevor man sample weil man möchte natürlich zuerst mal die oberflächen definition erstmal,hinbekommen,bevor man dann sample dann ist das immer so eine kombination zwischen gutes timing wann haben wir denn die daten wann sind sie gut genug und.
Tim Pritlove 0:30:29
Können wir dann endlich mal loslegen.
Tra-Mi Ho 0:30:30
Dann können wir denn eigentlich dann los.
Tim Pritlove 0:30:31
Weil jeder tag der mission dieses länger dauert erhöht natürlich das risiko dass irgendwas ausfällt.
Tra-Mi Ho 0:30:36
Irgendetwas ausfallen.
Tim Pritlove 0:30:37
Irgendwann ist ja auch die zeit abgelaufen und man muss dann auch wieder los.Was zurückbringen will und das war ja bei der fall trotzdem hat das ja dann funktioniert das heißt auch wenn der länder nicht funktioniert hat und man durch ihn keine weiteren informationen bekommen konnte,ist dann das mutterschiff ist.Ich hätte jetzt fast gesagt auf crashkurs gekommen aber es ist ja sozusagen der hat sich ja direkt auf diesen asteroiden herabgesetzt.
Tra-Mi Ho 0:31:06
Ja genau hat sich sogar hingelegt für eine für eine kurze zeit.
Tim Pritlove 0:31:11
Ja und dann und dann gegraben oder vorher was reingeschossen wie wie läuft das dann ab.

Tra-Mi Ho 0:31:15
Die proben name läuft durch einen touchdown go verfahren nennen wir das heir booster hat,horn ein sample horn wird er genannt das ist ja so ein langer trichter,das mutterschiff nähert sich dem asteroiden sehr langsam und sobald dieser trichter die oberfläche berührt,ein signal zurückgeschickt das heißt es gibt kontakt und dann wird ein projektil auf die oberfläche geschossen und der aufgewirbelten staub,aufgenommen und in kleinen resources dann.Aufgefangen genau und die werden dann versiegelt und.Im mutterschiff und dann später sollten sie dann wieder auf der erde landen und so geht das normalerweise und so wird es auch geplant aber gerade dieser,es ist manchmal schwierig zu bekommen und eines der der manöver glaube ich der mission ist ja auch schief gelaufen weil es hießt,bei dem ersten bei der ersten probenentnahmen das kontakt da ist und es wurde sozusagen die probe entnommen aber letztendlich war es nicht der fall gewesen und,manche unserer japanischen kollegen haben dann gesagt da müssen wir noch ein bisschen aufpassen vielleicht war gab es ja irgendwie eine.Wolke die dadrüber flog dich sozusagen dann diesen trigger mechanismus aktiviert hat und ähm ja was das gehört ja dazu zu exploration es gab einen zweiten versuch ja.
Tim Pritlove 0:33:13
Auch mutig weil ich mein sich so mal so eben,da so in kuss position zu gehen sozusagen sich so nah an so einem objekt dran zu wagen hat ja eine ganze menge andere,probleme weil ich nehme an die solarpanelen sind dann immer noch komplett ausgefahren man mussalso mit so einem fragilen gerät an so eine alles andere als homogene struktur heran fahren da kontakt suchen und dann sich wieder verabschieden,na ja das ist auf jeden fall schon mal ein risiko für sich.
Tra-Mi Ho 0:33:44
Ja aber bei toka weiß noch leichter bei rico war es schwieriger weil die hatte einen,bauchbereich es auch bei es sieht es so aus als ob es sich um ein astronom,ein asteroid handelt der aus zwei teilen besteht und dieser mittlere bereich der war sehr sehr eben und entsprechend,hatte man natürlich sich auch darauf konzentriert dann die ebene fläche zu nehmen für das sample wobei wenn es natürlichkarate reicher ist wenn es die struktur viel viel steiniger ist ist es natürlich schwieriger und das war bei ruhig der fall.
Tim Pritlove 0:34:25
So um vielleicht mal hayabusa abzuschließen also diese proben wurden dann entnommen und versiegelt viel war's nicht ich glaube so ein gramm oder sowas und größer viel weniger.
Tra-Mi Ho 0:34:37
Nein viel weniger viel viel weniger ja genau.
Tim Pritlove 0:34:41
So in der größenordnung von mikrogramm oder.
Tra-Mi Ho 0:34:43
Milligramm genau.
Tim Pritlove 0:34:46
Aber das hat man dann nach hause gebracht.
Tra-Mi Ho 0:34:48
Hat man nach hause gebracht ja.
Tim Pritlove 0:34:49
Im richtigen moment hat man sich dann quasi von den frieden wieder entfernt ich nehme an wenn so die erde einmal rum war man reist ja im anflug quasi erstmal mit der erde mit holt sich vielleicht noch irgendwo schwung,und dann,man hinter dem asteroiden hinterher und versucht ihn langsam einzuholen aber nicht zu überholen also man muss sozusagen immer langsamer werden rosetta hat's ja ähnlich gemacht mit dem kometen,und dann ist man dort und dann muss man aber auch irgendwie wieder die energie haben.
Tra-Mi Ho 0:35:21
Sozusagen um dann.
Tim Pritlove 0:35:23
Sich wieder der erde anzunähern.
Tra-Mi Ho 0:35:24
Ja so ist das und gerade bei mir war es ja so dass sie eine verzögerung ja bekommen haben weil es mit der brummt entnahme nicht zu,geklappt hat und es letztendlich haben sie dann auch,das in kauf genommen dann mit einer verspätung von drei jahren dann wieder auf die erde zurückzukommen sie hat,natürlich auch auf dem heimweg dann noch andere probleme da sind auch ihre rasters dann ausgefallen und eines nach dem anderen.
Tim Pritlove 0:36:01
Dem motto was schiefgehen kann geht auch schief.
Tra-Mi Ho 0:36:04
Geht auch schief ja aber das schiff war hat sich doch irgendwie berappelten und,ist noch geschafft die proben dann abzusetzen.
Tim Pritlove 0:36:16
Absetzen heißt das quasi so eine kleine kapsel wo die proben drin sind.
Tra-Mi Ho 0:36:20
Die wurde separiert.
Tim Pritlove 0:36:21
Genau über der erde dann sozusagen runter geworfen.
Tra-Mi Ho 0:36:24
Ja genau ja und ähm,die kapsel wird sozusagen separiert fällt dann auf die erde landete auf das ist in australien und zwei ist dann entsprechend dann sozusagen in der atmosphäre verglüht.
Tim Pritlove 0:36:41
Diese kapsel war wahrscheinlich nicht besonders groß.
Tra-Mi Ho 0:36:45
Die ist auch nicht klein ich glaube sie ist ja jetzt zeige ich es ihnen zu.
Tim Pritlove 0:36:51
So ein halber meter.
Tra-Mi Ho 0:36:52
So ein halber meter ja genau.
Tim Pritlove 0:36:55
Weil ja auch eine ganze menge hitze sozusagen hitzeschild mit dabei sein müssen wenn der eintritt in die atmosphäre stattfindet aber es ist nicht extrem schwierig,so ein rück wurf so zuverlässig zu machen mal klar man kann das irgendwie alles berechnen aber es ist ja sehr viele unwegbarkeiten drin wenn ihr so ein stück metall auf die oberfläche trifft und,thermische dynamiken sich da voll entfalten alles was die physikalische gesetze so hergeben oder muss man das ding ja auch noch finden.
Tra-Mi Ho 0:37:23
Ja das stimmt.
Tim Pritlove 0:37:24
Wie macht man denn das also wie stellt man denn sicher dass man es auch.
Tra-Mi Ho 0:37:28
Wiederfindet.
Tim Pritlove 0:37:29
Und wie stell mal vor allem sicher dass irgendwo runterkommt wo man auch eine chance hat es wiederzufinden.
Tim Pritlove 0:37:35
Deswegen australien wegen großer.
Tra-Mi Ho 0:37:37
Wegen der großen fläche genau dass es auch kein kollateralen schaden irgendwie dann birgt das ist auch irgendwie zivilisation fällt das wäre ja auch ein no-go,ich gebe zu jetzt müsste ich nachgucken aber ich würde mich nicht wundern wenn es auch irgendwie in art prinzip gibt der sozusagen ein peilsender.
Tim Pritlove 0:37:59
Peilsender sozusagen.
Tra-Mi Ho 0:38:01
Der den leuten sagen dass wo man so suchen muss ja.
Tim Pritlove 0:38:06
Sonst wäre im vergleich die nadel im heuhaufen gerade.

Tim Pritlove 0:38:11
Okay hat aber so auf jeden fall funktioniert und auch wenn einiges schief gegangen ist das ist ja dann auch eigentlich immer gut für so eine mission also es ist doof für die mission in dem moment aber es ist halt,gut weil man einfach so viel draus lernen kann und weiß so ah okay wer hat ein triebwerk probleme werden softwareprobleme gravitations messung probleme wir hatten probleme mit sonnenstürmen wir hatten probleme der datenübertragung wir hatten probleme unserer lage regelung alles möglicheda müssen wir jetzt nochmal beigehen und jetzt machen wir das irgendwie alles besser und dann,habe ich ja vorhin schon erwähnt gab es ja relativ schnell die entscheidung so okay alles klar in unserem großen plan gehen wir jetzt auch den nächsten schritt und mach nochmal busser zwei,was hat man denn aus diesem proben,herausziehen konnten also haben denn diese proben diese paar milligramm,zeug die man da eingefangen hat schon auch irgendein versprechen eingelöst oder hat es einfach nur lust auf mehr gemacht oder war das dann zu wenig so hart doof hat,hat nicht gereicht wir brauchen noch mehr von dem zeug was was war so die primäre motivation im prinzip dasselbe nochmal zu machen.
Tra-Mi Ho 0:39:23
Im prinzip dasselbe nochmal zu machen wie gesagt,es gibt ja eine roadmap das heißt es war klar dass sie auch eine zweite mission starten werden es war war das ein typ asteroid,hier ist ein asteroid,der unterschied ist das typ asteroiden dabei handelt es sich um steinige asteroiden die deren zusammensetzung wahrscheinlich aus,material besteht aus der oli wien und aus silikat,gestein in vor allem und das hat sich auch bewahrheitet.Wenn man sich die proben angeschaut hat bei.
Tim Pritlove 0:40:11
Das wusste man vorher eigentlich nur aus der spektralanalyse.
Tra-Mi Ho 0:40:15
Genau auf den.
Tim Pritlove 0:40:15
Das ding im teleskop angeschaut.

Tra-Mi Ho 0:40:17
Hat dann die spektral des spektrums angeschaut und entsprechend hat man dann werden dann die asteroiden dann in in typen oder in klassen unterteilt und wenn das spektrum vielchillie karten aufweist dann oder an an mineralien dann klassifiziert man sozusagen dann diese asteroiden in die typasteroiden und die steinigen asteroiden sind zwar interessant aber wenn es um die wissenschaftliche frage gehtwie ist denn das leben entstanden auf der erde wie ist wasserauf die erde gekommen wie sind die komplexen moleküle auf die erde gekommen und eines der hypothesen ist ja,ruinen oder kometen einschläge so sind asteroiden die eben kohlenstoff verbindungen interessanter die vielleicht organische elemente aufweisen unddas sind dann eher die asteroiden die ein spektrum aufweisen die vielleicht mehr in diese richtung gehen also.Die nennen wir das sind die asteroiden also die die mit kohlenstoff bindungen es gibt auch ptyp asteroiden da werden auch dann eher mehr organische elemente vermutet und es gibt auch asteroiden die sind sogar die darf man gar nicht anfliegenweil das planet harry protection so,streng ist dass da auch die vorkehrungen einfach viel komplexer sind.
Tim Pritlove 0:42:01
Weil man da so viel wertvolles drauf erwähnt dass einfach mal so hinfliegen und rein reinfliegen und drin rumschippern ist einfach mal geht gar nicht.
Tra-Mi Ho 0:42:08
Man also die die darf man gar nicht mehr anfliegen genau ja oder.
Tim Pritlove 0:42:13
Sozusagen so dass dass das space privataudienz und naturschutzgebiet so.
Tra-Mi Ho 0:42:17
Genau und.Bei handelt es sich eben um einen typ und das war auch das nächste ziel der jagd gewesen zu sagen okay jetzt haben wir ein typ asteroiden untersucht aber jetzt wollen wir einen typ steroiden untersuchen und schauen,da diese verbindungen gibt es da wasser vorkommen,was wir sozusagen dann verbinden können mit dem mit der frage der entstehung des lebens auf der erde und ja also es war,dementsprechend für die jagd klar dass sie so eine mission starten das ist so schnell ging ist wahrscheinlich auch dem hype,geschuldet der natürlich dann in japan groß war das war die erste japanische mission die eine probe zurückgeführt hat oder überhaupt das ist so gut angekommen dass die jagd gedacht hat dann eben,so schnell wie möglich legen wir noch einen nach ja.
Tim Pritlove 0:43:18
Ich habe gerade mal geguckt ja also von diesen kategorien gibt's ja eine ganze reihealso ist ja mit c und davor ist es ja noch lange nicht getan hier gibt's a b c d e,f g und dann geht's nicht mit haar weiter pr vr x aber die typen die man kohlenstoff sind die häufigsten astrid,das heißt man wollte auch mal sich das angucken was quasi so der klassiker ist und der.
Tra-Mi Ho 0:43:45
Der klassiker ist ja.Und für leute die gerne astrid mining machen die würden natürlich gerne zu den typ zu reden gehen fliegen.
Tim Pritlove 0:43:56
Weil da sind die tollen sachen.
Tra-Mi Ho 0:43:58
Ja genau.
Tim Pritlove 0:44:02
Ok also die metallischen.
Tra-Mi Ho 0:44:03
Die metallischen genau und man erhofft sich die seltenen erden darauf zu finden ob das so ist ja.
Tim Pritlove 0:44:10
Zuletzt wir werden sehen gut also zwei wurde dann konzipiert und das ziel war klar rio go.Sollte angeflogen werden und ich habe.Ich habe da mal geguckt es gibt ja eine eine schöne geschichte also auch dieser name ist nicht so ohne weiteres gewählt worden sondern das ganze ist so eine japanischelegende folklore wo ein,zusammen ein ein mensch eine schildkröte rettet und dafür belohnt wird mit einer reise zu einem unter wasser drachen palast,um von dort dann mit einer mysteriösen schachtel zurückzukehren die ja.Irgendwas enthält auf jeden fall,öffnet er sie dann am schluss auch und wird aber so ein bisschen bestraft weil also zurückkehrt hat er festgestellt dass irgendwie hundert jahre unterwegs war aber offensichtlich nicht gealtert ist.Erst also die schachtel dann öffnet als bestrafung wird ihm das alter dann wieder.
Tra-Mi Ho 0:45:30
Wieder.
Tim Pritlove 0:45:30
Gerechnet das fand ich jetzt wirklich ein extrempassenden namen oder beziehungsweise schöne geschichte wunderbar dazu passt war ja dieses ganze reisen im weltall ja dann auch immer so viel mit relativität und zeit zu tun hat also im prinzip bisher in dieser japanischen legenden geschichte die ganze raum zeit verzerrung.
Tim Pritlove 0:45:50
Perfekt.
Tra-Mi Ho 0:45:52
Perfekt genau ja aber wir mussten lange mit einem anderen namen arbeiten also ruhig go ist.
Tim Pritlove 0:46:01
Weil es noch kein gab.
Tra-Mi Ho 0:46:02
Weil es noch kein gab also wir in unseren dokumenten hieß roku sehr lange neunzehnhundertneunundneunzig underst als es zum launch sozusagen gekommen ist hat ja dann der asteroid auch seinen namen bekommen oder bestätigt bekommen weil das muss ja auch immer durch das ganze prozedere derund der internet.
Tim Pritlove 0:46:26
Julian.
Tra-Mi Ho 0:46:28
Genau und dann durften wir oder mussten wir dann unsere dokumente entsprechenden aktualisieren ja.
Tim Pritlove 0:46:36
Haben sich auf jeden fall schönen namen ausgedacht wie war denn das jetzt überhaupt mit der zusammenarbeit ist ja auch mal wiederungewöhnliches im weltraum aber in diesem fall während glaube ich die erste mission noch sehr viel japan zentriert war also die ganze entwicklung satellite et cetera auch die länder technik,komplett in japan entwickelt wurde hat man sich jetzt hier sehr viel breiter aufgestellt unter anderem das drk mit ins boot genommen wer war denn noch mit dabei.
Tra-Mi Ho 0:47:01
Also dabei international ist es vor allem über messgerät dass der und die knäste,hat.
Tim Pritlove 0:47:14
Also die franzosen.
Tra-Mi Ho 0:47:15
Die franzosen genau und hatte auch noch nasa im im team weil die haben dann die deep-space antennen gestellt,ja genau aber auch hayabusa hätte,internationaler sein sollen und es ist auch wahrscheinlich der grund warum es geht dann so geworden ist wie messgerät ist weil auch bei hayabusa hätte es,zusätzlich zu den minerva rovers hätte es rover noch untergebracht werden sollen aber der gps rover wurde im laufe der zeit dann wieder,entfernt.
Tim Pritlove 0:48:01
Weil die nasa sich zurückgezogen hat aus.
Tra-Mi Ho 0:48:03
Die nasa hat sich zurückgezogen hat und entsprechend war dann dieser platz frei und da zwei busse eins mehr oder minder,baugleich sind bis auf,einige wenige verbesserungen war eben auch diese charity da die für einen möglichen europäischen länder zur verfügung gestellt wurde.
Tim Pritlove 0:48:28
Also der slot vor quasi die sonne dann drin ist und rausgeschubst wird.
Tra-Mi Ho 0:48:32
Genau und.
Tim Pritlove 0:48:35
Und dann fiel die wahl aus ddr.
Tra-Mi Ho 0:48:36
Dann fiel die wahl auf das drk das der grund war dass wir nein plank immer der grund war dass,die jagd und die elsa eine mission geplant haben das ist die marco polo mission gewesen und die marco polo mission hätte zu einem asteroiden auffliegen sollen und,da wurde ein länder vorgeschlagen,vom drk für die mission die marco marco polo mission und diese marco polo mission hätte sein sollen auch mit der jacksondann ist aber marco polo nicht ausgewählt worden und,dann sind die japanischen kollegen dann auf uns zugekommen und haben dann gemeint ja,ihr seid jetzt so zu sagen habt ihr ja so eine studie gemacht und wenn das jetzt nicht klappt mit marco polo warum wollt ihr den nicht auch etwas studieren für uns,weil wir werden auf jeden fall eine folge mission machen die zwei mission und es wäre doch schön wir haben.Bisschen platz zufällig und wenn ihr etwas entwickeln könnt was genau darauf passt dann würden wir euch mit.
Tim Pritlove 0:49:59
Und zu dem zeitpunkt war ja wenn ich das jetzt richtig sehen der timeline auch rosetta schon lange in planung oder sogar schon unterwegs.
Tra-Mi Ho 0:50:05
In planung ja.

Tim Pritlove 0:50:07
Das heißt so länder ist jetzt auch so ein thema beim ddr und auch nochmal ganz interessant finde ich,also marco polo ist vorgeschlagen worden ist da nicht genommen wordenaber das heißt ja nicht dass er nicht schon relativ viel intelligenz darauf verwendet wurde wie denn das so ist das steht jetzt nicht nur so auf ein blatt papier macht man sich auch wirklich intensiv über alle komponenten sehr viel gedanken,muss auch ein bisschen frustrierend sein eigentlich für wissenschaftler wenn man da so viel zeit und energie investiert sagst du ja das wäre jetzt mal eine super mission und dann hast du die politik in sachen an die kein geld,oder und dann,hat man dann so ein jahr vielleicht an so einem so einem plan gearbeitet aber es ist halt nicht unbedingt immer alles für die katz weil kann ja sein dann kommen japanischen kaiser und sagen.Können wir ja mal zusammenkommen so war es jetzt auf jeden fall und dann ging's los sozusagen und da waren sie dann von anfang an mit dabei.
Tra-Mi Ho 0:51:02
Dann waren wir von anfang an mit dabei ja und nichtsdestotrotz weiß,wir hatten natürlich die marco polo studie durchgeführt aber die anforderungen von der jagd war doch.Bisschen anders ich würde sagen das ist untertrieben,weil hatte ja nur diesen diesen platz zur verfügung und,das warzwanzig mal zwanzig mal dreißig zentimeter und das ist ja nicht viel größer als eine schuhbox und sie meinten sie haben zehn kilogramm zur verfügung und.Wir sollten mal etwas entwickeln.
Tim Pritlove 0:51:47
Macht mal was damit ja.
Tra-Mi Ho 0:51:48
Genau was da reinpasst ja.
Tim Pritlove 0:51:52
Und was also okay,und was wusste man über den asteroiden zu dem zeitpunkt schon weil das ist ja dann sozusagen auch eine größe mit der man arbeiten muss wenn man jetzt dinge konzipiert und dinge größenordnungsmäßigen versucht einzuschätzen.

Tra-Mi Ho 0:52:11
Also man wusste wenig also man weiß natürlich den spektral typ das ist ein typ asteroid ist also kann man sich vorstellen was man was einen erwartet aber,auch weiß manmehr oder weniger die größe wenn man die größe nicht wüsste dann wäre wäre es noch schwieriger aber wir wussten dass circa ein kilometer als durchmesser hatund was wichtig natürlich für die haie busse zwei mission ist die bahn elemente solche dinge sind bekannt aber wie,wirklich der asteroid aussieht das wussten wir nicht und wir waren auch sehr sehr überrascht also ihnen dann gesehen haben dann letztendlich vom nahen und,man tut sozusagen dann seine technologie sein system,gegen diese unbekannte dann entwickeln und es ist schwierig,man muss natürlich dann sich überlegen wie man ein system entwickeln kann dass mit.Im unbekannten terrain trotzdem agieren kann und man versucht natürlich so viel gesagt,in unserem engineering sagen wir dann auch so viel,business also dem system zu geben wie möglich also dass dassystem so robust ist wie möglich so dass es auch dann operieren und leben kann wenn das terrain doch ganz anders aussiehtals das was wir erwartet haben.
Tim Pritlove 0:53:50
Dann sprechen wir noch mal so ein bisschen in die mission rein also zweitausenddrei war dann der staat wie lange war der athlet unterwegs.
Tra-Mi Ho 0:53:58
Zweitausenddrei zweitausenddrei war.
Tim Pritlove 0:54:01
Zweitausendvierzehn ich weiß bei der ersten mission solange es ja noch nicht nein zweitausendvierzehn war der staat,und dann muss er erstmal wieder ein komplexer pfad gefunden werden weil man kann ja nicht direkt hin sonst fliegt man einfach dran vorbei.
Tra-Mi Ho 0:54:17
Nein ja.
Tim Pritlove 0:54:19
Sondern wie vorhin schon erwähnt man muss irgendwie ein pfad finden wie man sich mit der richtigen beschleunigung,hinter den flugbahn des asteroiden einreihen kann was war hier erforderlich jetzt um das zu erreichen.
Tra-Mi Ho 0:54:31
Ein östringen bei und dann viel viel steuerung der der rasters.
Tim Pritlove 0:54:42
Wie macht man denn eines fing weil wenn man jetzt sowieso erstmal also wo wo ist denn dann quasi die sonne das erste mal hingeschickt worden also überholt,man die erde komplett oder fällt man zurück also wie macht man den zwingen bei wenn man jetzt die ganze zeit daneben und hat einfach den normalen orbit ausgenutzt oder muss man sich nicht erstmal,entfernen um irgendwie so einen zwing bei auch richtig durchführen zu können.
Tra-Mi Ho 0:55:07
Also man muss sich entfernt natürlich von der erde um da.Sich sich dann sozusagen,in das richtige orbit zu bewegen und was ausgenutzt wurde ist natürlich dass man den impuls hat den man dadurch bekommt mit dem erdarbeiten,das heißt man geht dann schon mal um die sonne herum und es ist ähnlich wie mit der,wie die erde auch und dann zu gegebenen zeiten ähm,ist es ja so dass wenn man sozusagen mit der erde sich um die sonne dreht,ähnlichen orbit dann kommt man dann auch wieder an der erde vorbei und bekommt dadurch dann den schub,und danach hat dann zwei ein weiteren schub gemacht um sich dann aus diesem erdogan,sich herauszubewegen und sich dann dem anzunähern,und das hat dann auch noch circa zwei jahre gedauert,bis er sozusagen also bis zwei dann ähm den asteroiden eingeholt hat.An sich ist das ist der orbit,von zwei sehr straight forward also es ist sozusagen einmal mit der erde um die sonne dann erst ring bei und dann ging es direkt an in den asteroiden.Mit rein.
Tim Pritlove 0:56:49
Wie nah ist denn dieser astrid also man sagt jetzt erdnahen weil er ja überhaupt erst mal vorbeikommt,es ist ja nicht so dass er die ganze zeit um die alle herum kreis sondern hat ja selber noch sehr viel größeren arbeit der glaube ich weiß nicht sogar noch bis zur venus geht glaube ich im inneren und nach außen noch ein bisschen weiter wahrscheinlich.Also jetzt auch nicht so dass wir jetzt alle naselang bei uns vorbeikommt sondern es ist eigentlich ein vergleichsweise seltenes ereignis da muss man dann eben auch.Nicht nur das richtige timing habe um dahin zu fliegen sondern sozusagen auch zum richtigen zeitpunkt starten wenn man zu spät ist dann.
Tra-Mi Ho 0:57:21
Dann hätten wir nämlich noch warten müssen so ist das man muss natürlich das richtige timing haben für den launch und da gibt es auch nur bestimmte lounge windows ja die müssen wir dann abwarten.
Tim Pritlove 0:57:35
Also dezember zwanzig vierzehn ging's los dezember fünfzehn war dieser swing bei und dann hat's noch bis juni zwanzig achtzehn gedauert bis man dann da war.
Tra-Mi Ho 0:57:46
Zwei runden hat es nochmal gedreht.
Tim Pritlove 0:57:49
Und dann konnte man ja das erste mal schauen okay was haben wir denn jetzt eigentlich wirklich und sie meinte ja gerade sie waren ja alle sehr überrascht wovon.
Tra-Mi Ho 0:57:58
Von der form des asteroiden weil es sieht aus als ob es sich um ja ich würde sagen zwei pyramiden sich handelt die aufeinander,gesetzt.
Tim Pritlove 0:58:13
Diamant form so.
Tra-Mi Ho 0:58:14
Diamanten form die asteroiden forscher nennen das top shapedas ist die eine sache aber die andere sache ist natürlich dann umso näher wir kamen haben wir dann gemerkt dass die oberfläche sehr sehr,grob war dass es fast,nirgendwo ist auf dem asteroiden irgendwie ein ein terrain gibt welches,eben ist und das macht natürlich die landung auf dem asteroiden viel gefährlicher.
Tim Pritlove 0:58:56
Man muss ja dann auch noch die gravitation vermessen also das kann ja noch mit dazu.
Tra-Mi Ho 0:59:01
Ja das kam noch dazu aber das,zwei dieses mal sehr sehr gut gemacht sie haben mehrere messungen durchgeführt sie sind näher ran gegangen um dann sozusagen dann auch,die anziehung sozusagen des asteroiden dann zu messen zum space craft und haben das sehr sehr gut ermitteln können.
Tim Pritlove 0:59:27
Aber es gab keinen orbit.
Tra-Mi Ho 0:59:29
Es gab kein.
Tim Pritlove 0:59:30
Wurde nicht um den asteroiden herumgeflogen.
Tra-Mi Ho 0:59:32
Nein es ist wieder ein hufe prinzip gewesen das heißt zwei fliegt dann mit einer distanz von zwanzig kilometer neben dem asteroiden.
Tim Pritlove 0:59:45
Aber halt nicht auf der rotations achse des asteroiden sondern so ein bisschen versetzt sodass also quasi unter unter dem eigenen blickwinkel sich das ding die ganze zeit dreht.
Tra-Mi Ho 0:59:54
So ist das jafür die messungen wie zum beispiel die gravitation hat sich dann busse zwei der oberfläche immer und immer wieder angenähert es gibt dann diesedieses manöver sozusagen dazu dienen dann nicht nur die oberfläche besser.Zu charakterisieren sondern dann auch die separation und die die probenentnahmen dannzu trainieren.
Tim Pritlove 1:00:31
So das ist jetzt so quasi diese abtastphase man schaut erstmal womit er es denn zu tun das hat glaube ich so drei monate gedauert oder so.
Tra-Mi Ho 1:00:40
Das hat drei monate gedauert bis dann minerva zuerst und danach messgerät gelandet sind.
Tim Pritlove 1:00:48
Jetzt müssen wir mal was zu diesem line-up da sagen was damit geflogen ist weil es gab ja nicht nur ein länder sondern es gab vier länder oder drei.
Tra-Mi Ho 1:00:58
Vier inklusive messgerät sind dass wir.Ich glaube das ist eine lessons learned gewesen von oder von der hayabusa mission für das ähm,man anstatt einem minerva auch zwei fliegen kann oder so viele wie möglich die mina war,besteht aus eins eins und es handelt sich mehr oder weniger um.Gleiche rovers die sind identisch und das sind auch die die dann im september zweitausend achtzehn auf rücken gelandet sind und die minerva zwei,da haben wir nicht so viel davon gehört dass es auch so dass es mir so eine art,technologie demo war die man dann mitgenommen hat wenn sie denn.Passt und wenn sie klappt dann klappt sie und das war glaube ich,anders wie die minerva ein rovers vom design her aus.
Tim Pritlove 1:02:13
Ich glaube die einsam waren so so so zylinder artige länder und zwei war irgendwie so ein prisma artiges gerät also da hat man quasi so ein bisschen technologie test gemacht,so wir nehmen mal das was wir beim letzten mal leider nicht haben landen können guck mal ob das funktioniert aber falls es vielleichtdoch nicht so eine gute idee war das design haben wir ja noch ein anderes und dann kann man das eben auch gleich vor ort vergleichen weil es super gelegenheit weil man kommt ja jetzt nicht alle naselang am asteroiden vorbei,und wenn's passt und wenn man das in die pilot noch mit rein bekommt die dinger war ja auch nicht groß ne also das relativ kleine teile.
Tra-Mi Ho 1:02:50
Ja die waren nicht schwerer als eins komma zwei eins komma fünf kilogramm also je rover das ist natürlich,ich würde sagen ein zehntel von dem was messgeräte sozusagen wiegt und auch vielleicht unterzubringen dann von der masse.

Tim Pritlove 1:03:08
Kostet immer noch geld so ein kilo hochzukriegen aber im rahmen der gesamtkosten fällt es halt nicht mehr weiter ins gewicht,was hat man denn jetzt für erkenntnisse bekommen weil ich denke mal wenn sie jetzt hier mit ihrem team sitzen man,die anspannung dürfte ja dann wirklich täglich steigen so also erstmal man kommt an klar dass er nach jahren,man arbeitet jetzt jahrelang hinter auf so einen so einen moment und dann dann dann findet das auf einmal statt so da fängt man ja wahrscheinlich schon mal an leichte erregung anzeichen von sich zu geben aber man weiß ja dann auch okay jetzt.Ab jetzt kommen neue daten und die müssen ja eigentlich am laufenden meter mit unseren bisherigen annahmen.Abgeglichen werden stimmt das passt das noch sind wir immer noch im selbenrahmen unserer berechnung gibt es irgendwelche grundsätzlichen erkenntnisse dass es vielleicht irgendwas komplett anders als als wir gedacht haben,haben dann diese also die ersten daten kam natürlich auf jeden fall erstmal vom vom satelliten selber als vom mutterschiff haben dann die länder auch,interessantes geliefert oder war das dann eher schon nicht so relevant.

Tra-Mi Ho 1:04:25
Für die,bilder gesehen haben zum ersten mal waren wir doch schon sehr schockiert weil wir haben riesige steine gesehen die auch sehr.Uneben waren jedoch wussten wir auch nicht und das konnte man auchbis zu diesem punkt noch nicht wissen wie groß diese steine waren weilman muss natürlich entsprechend auch referenzpunkt haben um zu wissen wie man sozusagen die bilder,wie man sozusagen die messungen dann festlegen kann bei minerva war das am anfang auch schwierig ich glaube inzwischen haben die kollegen natürlichdaten ausgewertet aber zwischen der minerva separation und der messgerät separation des fahren ja höchstens zehn tage glaube icheinundzwanzigster september bei minerva und dritter oktober war war schon da hatten wir natürlich gar keine zeit umirgendwie daraus dann wirklich relevante daten dann für uns zu generieren somit haben wir dann mit den orbit daten vor allem mit dem mutterschiff daten gearbeitetundes war schwierig da eine landesstelle zu finden weil was wir auf jeden fall vermeiden wollten ist das messgerät.Irgendwie und die gefahr war groß wenn man sich die oberfläche bilder angeschaut hat es war steinig es war zerklüft,wenn so eingekeilt zwischen zwei steinen liegen sollte da hätte glaube ich.Mobilitätsverlustes hätte es nicht geschafft den ländern herauszubekommen und eines unserer referenz information waren dass aufgrund von dervon der größe des landes und von den größen verteilung der gesteine auf der oberfläche wir doch.Bitte steine vermeiden sollen die so um die fünfzig zentimeter sind und die mehr oder weniger mehrere,zentimeter bis zu fünfzig zentimeter so voneinander liegen entfernt liegen,das ist schwierig weil man nämlich gar nicht weiß sind die steine die wir sehen ist das wirklich fünfzig zentimeter was wir da aussehen mit der auflösung die die bilder des mutterschiffs sozusagen uns geliefert hat ist das wirklich.Ist das vorhin steine wirklich nur fünfzig zentimeter ist oder sehen wir nur den oberen teil und da drunter sieht es wiederum ganz anders aus,des eisbergs sozusagen solche informationen konnten wir natürlich nicht extrahieren,das ist eine ungewissheit mit der wir sozusagen bei unserer vorbereitung mehr oder weniger leben mussten und sagen müssen okay,haben wir die daten die wir haben und wir müssen so eine art risiko abschätzung machen und für uns selber dann schauen wie groß ist denn das risiko,das stecken bleibt und zu zu anderen risiken sind ja noch andere da.
Tim Pritlove 1:07:46
Man muss vielleicht mal was.Nochmal dazu sagen wie diese länder jetzt eigentlich alle ausgestattet waren also waren natürlich sehr unterschiedlich die minerva eins hatten nur kameras und ein thermometer.Also es war wirklich so kann bilder machen und weiß wie kalt es ist so dass auf jeden fall schon mal eine interessante information,und der minerva zwei waren glaube ich ähnlich aber hatte zumindest schon mal so noch so ein beschleunigungssensor und konnte auch staub detektieren.Und wieso mit leds hat aber glaube ich kein gesehen aber was jetzt,und die dem mascara auch vereint ist,alle also weil wir sagen die rover,aber das ist ja nicht so ein rover im sinne von fahrzeug mit rädern was über die oberfläche fährt sondern alle hatten sozusagen dieses prinzip eines.
Tra-Mi Ho 1:08:49
Hüpf mechanismus.
Tim Pritlove 1:08:51
Hüpfen es genau also mit so einem schwungrad die im,im körper im gerät selber drin war also quasi ein einfacher drehmoment tor und das schwungrad dreht man auf so eine magische art und weise holt quasi so einmal schwung,und dann konnten die hüpfen und sind die dann auch gehüpft.
Tra-Mi Ho 1:09:11
Sie sind gehüpft alle.
Tim Pritlove 1:09:13
Alle sind gehüpft.
Tra-Mi Ho 1:09:13
Alle sind gehüpft und minerva eines der minerva du richtig weit sogar also natürlich nicht in einem sprung aber anscheinend ist es wirklich schon also über,mehrere kilometer hinaus ist es anscheinend über die oberfläche hat er sich fortbewegt.
Tim Pritlove 1:09:34
Weil sie einfach immer so gehüpft in so zehn fünfzehn meter springen oder sowas.
Tra-Mi Ho 1:09:39
Ich weiß nicht ob es zehn oder fünfzehn meter waren in einem sprung oder ob es mehrere kleine sind aber dadurch dass die minerva rovers länger lebt,als der maske länder war es für sie natürlich einfacher sequenzielle sozusagen sich dann weiter und weiter sich fortzubewegen.
Tim Pritlove 1:10:01
Die energieversorgung war ja irgendwie also die die lova seminar was die hatten ja glaube ich solarzellen und eine zumindest der zweite nicht.
Tra-Mi Ho 1:10:13
Also die ersten zwei ja beide.
Tim Pritlove 1:10:16
Also die eins eins eins.
Tra-Mi Ho 1:10:18
Eins eins.
Tim Pritlove 1:10:19
Messgerät hat aber sowas nicht.
Tra-Mi Ho 1:10:22
Nein messgerät hatte keine solarzellen die dann zu einer aufladung der batterien geführt hat,metzger that solarzellen aber das haben wir also nur einzelne die das waren das war ein zug system des gesamten systems,die sonneneinstrahlung sozusagen festzustellen und entsprechend dann als redundanz prinzip dann für die lage regelung des lenders.
Tim Pritlove 1:10:57
Wo kann man die energie her.
Tra-Mi Ho 1:10:58
Die kamen von batterien und zwar von nicht aufladbar batterien.
Tim Pritlove 1:11:04
Ja aber wir halten nicht aufladbar batterien ihre spannung über mehrere jahre weltall.
Tra-Mi Ho 1:11:10
Man muss sich sehr kühl lagern.
Tim Pritlove 1:11:13
Okay das ist noch relativ einfach.
Tra-Mi Ho 1:11:15
Ja das ist sehr einfach man darf man sollte versuchen ein design zu finden so dass die batterien sich nicht entladen und was wir dann natürlich auch gemacht,dass wir dann vor der landung dann die batterien,passivieren mussten natürlich weil wir ja diese schicht bekommen aufgrund von der langen lagerung der batterien um die batterien wieder frei zu bekommen aber,die batterien die wir eingesetzt haben die haben letztendlich auch die lebensdauer dann erlaubt die wir berechnet haben wir haben für,circa stunden,lebensdauer haben wir die batterien ausgelegt indem wir natürlich auch die flugphase mit berechnet haben und,es ist auch so rausgekommen also der länder hat ja siebzehn stunden überlebt.
Tim Pritlove 1:12:10
HmWarum nicht mehr also warum sechzehn stunden klingt jetzt ja nicht besonders viel wenn man jahrelang unterwegs ist und dann hat man nur so einen schuss und dann dann ist nach einem tag schon wieder alles vorbei,gab es wenig hoffnung noch mehr erkenntnisse zu haben wenn man länger im betrieb ist oder warum weil man damit zufrieden.

Tra-Mi Ho 1:12:32
Zufrieden waren wir natürlich nicht damit wir hätten viel lieber wenn maske länger gelebt hätte aber es waren einfach die umstände die,dieses design dann getrieben hat zum beispiel die baugröße es ist ja nicht großder länder das heißt wir könnten nicht sehr viel an batterien unterbringen und die masse ist ja auch nicht groß zehn kilogramm drei kilogramm alleine gehen schon für die wissenschaftliche nutzlasten wegdas heißt wir haben nur noch sieben kilogramm übrig gehabt um dann sämtliche,andere sub systeme wie kommunikation und wie,kontrolle system schwung und auch die,die ganzen wieder,energie verteilungsschlüssel dass das in all diese dinge die dann untergebracht werden und das ist da ist nicht mehr so viel übrig die struktur selber müssen wir ja auch noch berücksichtigen unddavon also das zusammen dann sieben kilo da hatten wir nichtso viel mehr an masse aber wir haben uns neben diesen strikten anforderungen die uns dann gegeben wurdeauch eine art risikobewertung gemacht und.Wir wiederaufladbare batterien genommen dann hätte es sich das design ändern müssen weil wir,dann noch mehr fläche gebraucht und diese fläche hätten wir nur dadurch ermöglichen können dass wir ein solarpanels noch zusätzlich drauf montiert hätten und es dann aufgeklappt,hätten das abgesehen davon dass das dann wiederum schwierig ist für die mobilität,das bedeutet dass wir dann die panele wieder zuklappen müssen um dann zu springen kommt natürlich die gefahr hinzu dass der mechanismus vielleicht gar nicht klappt,vielleicht weil es einfach viel komplizierter ist.
Tim Pritlove 1:14:40
Das ist so eine einfache batterie wo einfach strom drin ist und anschalten und fertig.
Tra-Mi Ho 1:14:44
Das war sozusagen besser es war die erste mission mit so einem größeren länder sozusagen auf einem asteroiden zu landen und,da haben wir dann gemeint wir wollten das design so einfach wie möglich machen auch wenn das dann gegen eine längere betriebsleiter zeit spricht aber es garantiert uns zumindestens sechzehn stunden,und man.
Tim Pritlove 1:15:11
Hat man ja auch gesehen bei filet bei der rosetta mission da ist es ja im prinzip schief gegangenda ist genau das passiert was ja eigentlich auch vermeiden wollten man ist in so einer blöden spalte gelandet weil halt beim aufsetzenalles ja,alle geplanten halte maßnahmen sozusagen alle nicht funktioniert haben das ding hüpfte dann mehr oder weniger unkontrolliert über den kometen und ist dann in irgendeiner dusseligen spalte hängen geblieben wo dann halt die sonneneinstrahlung so schlecht war,dass eben kein strom mehr generiert werden konnte und dann gab es noch ein paar hilferuf und das war's.
Tra-Mi Ho 1:15:44
Und das war's ja so ist das und ich meine dass wir das entwickelt haben oder konzipiert haben da,war die landung von vielen natürlich noch etwas weitaber uns war es es war uns schon bewusst dass solche dinge passieren können das messgerät in einerlampen könnte wo wirklich gar keine sonneneinstrahlung passiert und dann mit so einer geringen masse dann sozusagen das lebenserhaltungssystem dann aufzubauen das war uns wiederum viel zu risikoreich.
Tim Pritlove 1:16:18
Ok aberdass die spalte war natürlich dann trotzdem noch eine gefahr gar nicht mal wegen mangelnder sonneneinstrahlung soll weil man hätte sich ja auch vorstellen können dass man so zwischen zwei steine eingeklemmt ist wo dann diese schwungrad technik so nicht mehr funktioniert.Weil die bewegung ja nur funktioniert wenn auch raum da ist.
Tra-Mi Ho 1:16:37
Wenn ein raum da ist und auch weil es nur begrenzt ist in seinem freiheitsgrade weil wir haben natürlich ein schwungrad wenn man sich anschaut als xy,koordinatensystem dann schwingt sozusagen dass der schwung sozusagen in entlang der,ebene das heißt die.Ebene könnte man ja gar nicht beeinflussen wir haben natürlich aufgrund von unseren simulationen herausgefunden dass dadurch dass das ist wiederum der vorteil wenn man kein.Ebenen asteroiden hat dass gerade diese unebenheit natürlich die mobilität begünstigt das ist immer irgendwie ein schwung gibt so ein drall gibt der den länder aufrichten wird und,das ist wiederum der vorteil davon aber dadurch dass wir eben nicht diese zwei ebenen,aufrichten konnten wäre das stecken bleiben sozusagen das ungünstige stecken bleiben natürlich ja,nicht vom vorteil gewesen in dem moment.
Tim Pritlove 1:17:52
Dann gehen wir noch mal genau in diesen,sechzehn beziehungsweise siebzehn stunden slot rein also nachdem die anderen rover jetzt alle schon ihren spaß hatten und fleißig da auf dem,asteroiden rumgehüpft sind hieß es dann irgendwann so okay jetzt dürft ihr auch mitspielen,da wird ja sicherlich irgendeine detailabstimmung dann gegeben haben wie bereitet man sich denn bitte auch auf auf sechzehn stunden mission vor weil,man braucht ja dann vielleicht auch irgendwann mal eine mütze schlaf und ist ja auch nicht so dass man jetzt in der ersten minute aufsteht anschaut,wieder ins bett geht,das klingt für mich ja schon eher so dass um zweiunddreißig stunden tag den man da hat wie wie wie geht man denn da allein human du geistig rand.
Tra-Mi Ho 1:18:44
Wir hatten schichteneingeplant wir haben schichten eingeplant also in dem sozusagen dann die jeweiligen kollegen da sind und auchentsprechend dann auch aussagekräftig sind das heißt zum beispiel war uns klar dass für das power system wenn die batterien eigenschaftangeschaut werden dass dann da auch immer dann zwei experten da sind die sich das dann teilen also von der schicht her.Ich muss aber auch zugeben so richtig schlafen konnte weder ich noch die kollegen nicht das heißt dann haben wir es uns trotzdem von der ferne angeschaut,ferne und es ist ja auch dass man arbeitet schon seit jahrendaran da kann man auch in dem moment gar nicht schlafen irgendwann mal glaube ich auch im im laufe dieser siebzehn stunden waren die nerven auch manchmal dünn,ja und,aber trotz allem hat man sich zusammengerissen um da dann auch die richtigen entscheidungen zu treffen.
Tim Pritlove 1:19:57
Eine entscheidung die vorher getroffen werden musste ist wo,geht es denn eigentlich hin also das ding hatte ja dann auch glaube ich diesen kilometer durchmesser von dem man vorher ausgegangen ist also das hat soweit gepasst und war ja trotz dieser diamanten struktur eher,ja so ein typischer wie man sich so wie man sich früher wie man den achtziger jahren schon gespielt hat so so sah das ding irgendwie im prinzip auch aus also so eher rund nicht wirklich eine kugel aber halt irgendwie jetzt auch nicht so eine so eine lange flunder oder irgendwiesowas und,dann gab es die ganzen kamera bilder die gravitations messung etcetera und da muss man erst mal in so einem diskurs gehen wo will man jetzt eigentlich hin und wo kann man denn überhaupt hin als hätte man in prinzip an jedem beliebigen ort gekonnt.
Tra-Mi Ho 1:20:40
Nein wir durften es nicht weil wir,dann die annahme des mutterschiffs nämlich auch.
Tim Pritlove 1:20:52
Muss ja noch platz freigelassen werden.
Tra-Mi Ho 1:20:54
Also platz ist es weniger sondern es liegt daran dass auf der oberfläche weiß lackiert ist und das liegt daran dass wir das thermisch machen mussten.Um sozusagen die abstrahlen der der wärme sozusagen zu optimieren aber auch.
Tim Pritlove 1:21:13
Die wärme der sonne oder die wärme.
Tra-Mi Ho 1:21:15
Die sonneneinstrahlung der sonne und dann aber auch des gerätes das musste dann entsprechend dann optimiert werden und wir haben dann eine weiße lackierung genommen und diese weiße lackierung ist natürlich dann auch,wunderbar wenn es darum geht dann mit den kameras des mutterschiffs sozusagen den ländern wiederzufinden das ist natürlich etwas einfacher,aber dadurch dass bücher zu weit für ihre annäherungsversuch auch target markus,benutzt es handelt sich hier um reflektierende bälle die sie dann vorher auf die oberfläche schmeißen,anhand derer see dann sozusagen ihre navigation dann abspielen ist es so dass wir ein messgerät zu nahe wäredass dann die bustersmit den target marketers verwechseln könnte und das war eine gefahr dann für zwei und entsprechend gab es auch regionen die waren für meeske tabu,da durften wir nicht lange.
Tim Pritlove 1:22:23
Ok wie viel bleibt dann noch übrig von der rest fläche.
Tra-Mi Ho 1:22:26
Gott sei dank genug dass wir bis zu zehn möglichen kandidaten gekommen sind.
Tim Pritlove 1:22:30
Ok wie geht man dann davor dann kommt wir dieser krieg zwischen technikern und und wissenschaftlern.
Tra-Mi Ho 1:22:36
Dann kommt der krieg wobei das beim sc war es einfacher,weil missgeburt hatte so viele wichtige forderungen technisch,auf technischer seite gesehen dass die wissenschaftler das auch akzeptieren mussten weil sonst hätten sie ja ihre daten eigentlich bekommen und eines dieser war dass wir eben nur sechzehn stunden haben und wir solampen müssen oder auf der stelle landen müssen so dass wir die beste kommunikation,haben und das hat was mit dem tag nachtsyndrom plus zu tun das heißt wir durften entweder nicht zu sehr im norden landen oder auch nicht zu sehr im süden weil dann wir wollten etwas haben was sozusagen einen guten tag nach zyklus hat,dann eine andere sache die auch sehr.
Tim Pritlove 1:23:27
Was für eine rotationsgeschwindigkeit hatte diese astrid eigentlich.
Tra-Mi Ho 1:23:31
Der routinierte mit sieben komma sechs stunden um sich herum.
Tim Pritlove 1:23:37
Quasi in diesen sechzehn stunden war zwei rotationen.
Tra-Mi Ho 1:23:39
Zwei rotationen mitgezählt und dann eine andere sache war auch die thermischen.
Tim Pritlove 1:23:49
Und man wollte jetzt viel tag haben also man wollte die sonne immer dabei haben oder eher nicht also es ist die sonne jetzt eher hinderlich oder eher hilfreich.
Tra-Mi Ho 1:23:59
Sonne wir brauchen die sonne und kommunizieren und das heißt wir müssen dann so viel wie möglich an tag haben.
Tim Pritlove 1:24:07
Warum braucht man die sonne zum kommunizieren.
Tra-Mi Ho 1:24:09
Weil haie boostet sei nämlich nur auf haie booster zwei sind nur auf der sonnenseite immer gerichtet,weil haie busse zwei der orbit von high,selber auch noch licht brauch von der sonne das heißt heir busse zwei hatte immer die sonne im rücken und die konstellation war entsprechend immer so dass wir dann immer nur mit dem mutterschiff kommuniziert haben wenn tag ist.
Tim Pritlove 1:24:31
Okay verstehe.
Tra-Mi Ho 1:24:32
Sobald es nacht war gab es dann gar keine kommunikation und.
Tim Pritlove 1:24:36
Also möchte man irgendwohin wo möglichst viel tag ist.
Tra-Mi Ho 1:24:41
Aber auch wiederum nicht zu viel weil mit viel tag verbunden ist auch dann vielleicht,thermischer verhalten,der oberfläche dass der da die stelle sich dann viel mehr aufwärmt und das wäre auch nicht gut für unsere messgerät länder weil dann hätte sich dann der länder aufgeheizt.
Tim Pritlove 1:25:03
Wie weit waren wir eigentlich von der sonne weg zu dem zeitpunkt also wo hat sich das ganze abgespielt als wirklich das rentenniveau stattgefunden hat.
Tra-Mi Ho 1:25:12
Das muss ich schauen aber ich glaube wir waren.
Tim Pritlove 1:25:14
Wie zwischen erde und maß oder,okay also so anderthalb so das heißt so von den temperaturen ist schon noch so vergleichbar quasi mit dem was auch bei der erde an energie ankommt ist es etwas weniger,aber es ist jetzt nicht wie jupiter oder neptun wo es irgendwie nur noch kalt ist sondern daher stand sozusagen auch eine gewisse hitze sprich wenn die sonne da drauf knallt dann passiert auch.
Tra-Mi Ho 1:25:36
Dann ist es schon wer warm genau und es ist auch so dass die ja so klein ist und das thema control system auch entsprechend optimiert wurde für einen bestimmten temperaturbereich,und man hat ja aufgrund von von dieser enge an instrumenten ist auch die,die interaktion der instrumente miteinander auch ganz anders als wenn man einen etwas größeren länder hatund wir mussten das berücksichtigen gerade für die wissenschaftliche nutzlasten und darf es nicht zu warm werden weil dann das signal zu rausch verhältnis natürlich dann schlechter wird,und für die batterien ist es so dass die batterien optimal bei zwanzig grad dann arbeiten.Man entsprechend dann auch diese zwanzig grad halten muss.
Tim Pritlove 1:26:28
Okay das heißt wir haben jetzt hier schon schon den ganzen blumenstrauß an an anforderungen viktor da muss irgendwie genug sich kontakt sein das sitzt sonne voraus die macht aber warm es darf dann auch nichtzu warm werden es darf auch nicht zu kalt werdenund dann hat man quasi so eine software da wirft man das alles rein und dann auf einmal schaut man quasi auch so ein modell dieses asteroiden wo ja wahrscheinlich dann farbliche markierungen sind wie optimalbestimmte bereiche jetzt wäre und am schluss bleiben so ein paar übrig und dann sagt man so okay jetzt dürften die wissenschaftler jetzt könnt ihr euch noch mal was aus.
Tra-Mi Ho 1:27:00
Könnt ihr euch mal was aussuchen.
Tim Pritlove 1:27:02
Aber drei vorschläge für euch so soviel war's ja wahrscheinlich.
Tra-Mi Ho 1:27:05
Also es waren zehn es waren zehn die noch in dem bereich sind aber sie wurden dann reduziert auf zwei.Und dann spielte dann natürlich dann auch wiederum es ist natürlich ein unterschied wenn wir jetzt zu den,missions analytiker sagen also es ist uns,wenn die genauigkeit der berechnung des des landes bereichs etwa um die zweihundert meter ist zum beispiel und wir,tieren dann eine kommunikation länge die ist am tag zwischen drei stundenrund vier stunden und dann sieht man dann auch dass je nach landesstelle es dann vielleicht drei komma vier stunden sind oder,drei stunden sind dann muss man das natürlich auch auswerten man muss sich das anschauen manchmal zählen ja selbst zwanzig minuten kommenkommunikation viel mehr,als als andere aspekte und das ist ein das ist eben diese auswertung diese abschätzung inwieweit wir sozusagen an marvin haben im system mit der landesstelle.
Tim Pritlove 1:28:18
Welche datenmengen hat das gerät so im idealfall aufzeichnen können so im verhältnis zu dem was was hoch gesendet werden konnte.
Tra-Mi Ho 1:28:28
Wir hatten insgesamt am ende jetzt muss ich schauen.
Tim Pritlove 1:28:33
Weil es ja sozusagen jetzt kommen die ganzen sensoren dazu also ist richtig sehe ist ja eine nochmal eine kamera an bord gewesen bei mascot so eine weitwinkelkamera es gab nochmal ein spektrometer.Frau roth spektrometer stimmt das ja genau und man newtonmeter und ein radio meter.
Tra-Mi Ho 1:28:56
Und ein radio meter.
Tim Pritlove 1:28:57
Das radio meter das hat radio gehört.
Tra-Mi Ho 1:28:59
Das hat die thermischen wellenlängen sozusagen untersucht und dadurch dann die ähm die temperatur eigenschaften des asteroiden bestimmt.
Tim Pritlove 1:29:14
Das wäre hätte ich ja jetzt eher vom infrarot spektrometer aber das ist eher zur zur bestimmung der.
Tra-Mi Ho 1:29:19
Der zusammensetzung der mineral logie genau aus es arbeitet im infrarotbereich weil die mineral mineralöle sind in diesem bereich,also vom spektrum her,haben sie dort ihre markierungen genau also messgerät hat insgesamt achtzig megabyte an daten.
Tim Pritlove 1:29:41
Zusammengetragen in.
Tra-Mi Ho 1:29:42
Zusammengetragen ja.
Tim Pritlove 1:29:44
Und die mussten ja dann sozusagen auch hoch.
Tra-Mi Ho 1:29:48
Die müssen alle hochkommen.
Tim Pritlove 1:29:50
Wie groß war dann der abstand zum zum zum mutterschiff in dem moment.
Tra-Mi Ho 1:29:57
Der abstand zu immer in einer distanz von zwanzig,kilometern geflogen aber für messi haben sie sich auf eine höhe von zwei bis drei kilometer äh haben sie sich dann ähm.
Tim Pritlove 1:30:18
Abgesenkt um um diese kommunikation zu.
Tra-Mi Ho 1:30:21
Um die kommunikation zu erleichtern genau also während der operation von messgerät war booster zwischen drei,zwei drei kilometer vom asteroiden entfernt.
Tim Pritlove 1:30:32
Und es hat aber auch gut funktioniert.
Tra-Mi Ho 1:30:35
Das hat sehr gut funktioniertdie daten sind auch sehr sehr schnell wieder zu erde zurückgekommen und unsere kollegen also auch hier mein dank an sie sie haben wirklich die daten uns so schnell wie möglich zur verfügung gestellt,und das hat uns sehr gut sehr geholfen.
Tim Pritlove 1:30:54
Die mussten ja dann auch erstmal wieder zurückkommen.
Tra-Mi Ho 1:30:57
Genau ja ein trip time oder die signal umlauf zeit zuzusagen beträgt ja dreißig minuten circa als maske gelandet ist also hin und zurück.
Tim Pritlove 1:31:11
Also vom vom satelliten zur erde und.
Tra-Mi Ho 1:31:14
Von erde zum satelliten und dann zurück ja.
Tim Pritlove 1:31:17
Also diese diese auswahl des landes ortes war dann auch glücklich gewählt.Also wenn man jetzt mal den moment mal des,knopfdruck quasi der ja natürlich nicht einen knopfdruck ist sondern man sagt okay dann und dann geht's los und dann weiß man es auch erst eine viertelstunde später ob's geklappt hat.Das wird dann sozusagen gemeinsam mit dem team des mutterschiffs ausgerechnet festgelegt etcetera was wurde dann gelöst damit damit der länder auch wirklich das schiff verlässt.
Tra-Mi Ho 1:31:59
Also gelöst wird es durch ein signal das heir busse zwei losschickt und dadurch wird ein,ein draht getrennt und durch die abtrennung des drahtes welches teil unseres separations-vorschau ist,ein aktuator initiiert der,sich dann löst und er schiebt dann unsere separations-vorschau hatte von dem hayabusa zwei mutterschiff weg,und dadurch wird auch messgerät aus dieser charity aus dieser interface zwischendem länder und dem mutterschiff dann heraus geschoben ganz langsam mit einer geschwindigkeit von circa drei zentimeter bis fünf zentimeter pro sekunde unddann geht der länder dann in diesen ballistischen abfall flug über.
Tim Pritlove 1:32:55
Also ich glaube bei bei bei rosetta und viele war das eine schraube die dann gedreht wurde um.
Tra-Mi Ho 1:33:01
Gedreht wurde genau.
Tim Pritlove 1:33:02
So macht man das auch.
Tra-Mi Ho 1:33:03
Das ist ähnlich ja genau.

Tim Pritlove 1:33:05
Also man schraubt sich quasi einfach in einer bestimmten geschwindigkeit heraus und dadurch.Kann man natürlich dann erstmal auch sehr genau sagen weil man ist wirklich losgelassen hat und man erstellt damit dann auch eben die gewünschte geschwindigkeit automatisch auch her.Okay ich glaube ich muss gerade mal nachgerechnet also für diese achtzig megabyte wenn man sechzehn stunden.Sechzehn stunden lang zeit hat zu senden aber er hat ja wahrscheinlich die ganze zeit gesendet ne von diesen sechzehn stunden konnte ja nur die hälfte gesendet werden,ungefähr naja auf jeden fall braucht man so zwanzig kilo bitte pro sekunde datenraten um das irgendwie runter zu bekommen so jetzt schwebt das ding also herunter und,fällt dann auf die stelle runter und es ist halt wirklich so als ob ich jetzt einen schuhkarton aus dem fenster raus schmeißen nur in zeitlupe.Tritt trifft dann irgendwie auf der war dann wahrscheinlich,na ja klar war der stabil gebaut aber es gab jetzt keinerlei lande füße oder sonst irgendwas hat halt einfach drauf geworfen und dann ist es irgendwie liegen geblieben,und dann.Kommt wahrscheinlich erstmal das große fragezeichen okay was jetzt passiert und man kriegt daten von dem länder der sagt ich liege jetzt wahrscheinlich.So schräg oder das kamerabilder also welche sensoren also woraus gewinnt man sozusagen jetzt eine information wo man ist wie man ist.
Tra-Mi Ho 1:34:38
Sensoren die die lage des landes bestimmen,es handelt sich hierbei um wir nennen es optiker proxima um led licht welches ausgesendet wird und dann wieder im idealfall zurück,wenn der länder dann auf einer bestimmten oberfläche liegt oder wenn er ihm leeren bereich liegt je nachdem welchefläche das aussendet dass wir dann zurück reflektiert und dann werden die signale bestimmt und dadurch dass diese ops an fünf seiten des lenders befestigt sind kann man das aus den daten dann feststellen obmessgerät richtig oder falsch liegt,richtig oder falsch liegt da die definition liegt darin ob die kamera und das radio meter auf dem boden zeigen und das mikroskop auch,auf dem boden zeigt das ist für uns die richtige lage für den länder wenn es geht dann fällt es runter wie sie gesagt haben ballistisch dann gibt es eine artbauen zink fase so eine art aufprall phase deren länge wir theoretisch zu simulieren können,aber nicht wirklich bestimmen können.
Tim Pritlove 1:35:52
Hängt davon ab wo man jetzt einen stein trifft und wie man fällt.
Tra-Mi Ho 1:35:55
Oder auch wie die oberfläche des asteroiden weicher ist es härter je nachdem kann es entweder bis zu fünfundvierzig minuten haben wir ausgerechnetdauern oder im idealfall bei maske letztendlich glaube ich schon nach zehn fünfzehn minuten lager wieder sozusagen.
Tim Pritlove 1:36:13
Fast eine viertel stunde rumgehüpft quasi bis er sich richtig beruhigt hat.
Tra-Mi Ho 1:36:15
Richtig beruhigt hat bis er sich richtig beruhigt hat.
Tim Pritlove 1:36:20
Ohne dass er jetzt also der hat auch nicht automatisch schon das schwungrad irgendwie zum einsatz gebracht um auf eine bestimmte also ist einfach erstmal nur runter gefallen und hüpft nicht mehr.
Tra-Mi Ho 1:36:27
Ist dann hüpft nicht mehr und dieses ich hüpfe nicht mehr signal und,ich schaue mir an in welcher lage ich mich befinde wird dann an den bordcomputer gesendet der verarbeitet da und wir haben auf messgerät eine art autonomie,das ist eine sehr simple autonomie die den länder dann bewegen soll dann entweder das schwungrad,zu animieren und zu sagen okay ich liege falsch also begib dich vielleicht in die richtige position oder wenn der länder in der richtigen position ist zu sagen okay jetzt liegst du richtig jetzt kannst du anfangen mit den wissenschaftlichen messungen,das ist so eine art zustands automat ja,falsch ja richtig oder nein falsch und dann entsprechend wird dann der algorithmus initiiert um den länder dann entweder in die richtige lage zu bringen oder dann die messungen zu beginnen.
Tim Pritlove 1:37:25
War das erforderlich.
Tra-Mi Ho 1:37:26
Das war erforderlich weil wir wollten wir hatten ja nur.
Tim Pritlove 1:37:31
Ich meine war es konkret auch erfolgreich also ist er auf der richtigen oder auf der falschen seite gelandet.
Tra-Mi Ho 1:37:35
Das war ein krimi an sich wir gehen davon aus aus den daten die wir haben dass er auf der falschen seite gelandet ist dann das auch richtig detektiert hat.
Tim Pritlove 1:37:50
Dass wir mit dem butterbrot eigentlich ne also es selbstverständlich landet man mit der butter auf den boden.
Tra-Mi Ho 1:37:55
Immer auch auf dem asteroiden.
Tim Pritlove 1:37:59
Wissenschaftlich erwiesen.
Tra-Mi Ho 1:38:00
Auf der erde oder auf dem asteroiden und dann kam es auch zum aufrichten mechanismus und,dann haben die sensoren die signale wieder zurückgegeben,an den bordcomputer und der on bordcomputer oder der algorithmus hat die signale als wir sind jetzt in der richtigen position fange an zu messen interpretiert.
Tim Pritlove 1:38:30
Wie cool bleibt man in dem moment wo man so ein signal kriegt.
Tra-Mi Ho 1:38:34
Also ich würde sagen cool istfalsch ich war erleichtert und ich glaube die meisten von uns man erleichtert in dem moment als der länder sozusagen dann auf dem boden dann die ersten signale zurückgeschickt.
Tim Pritlove 1:38:52
Weil es ja nicht nur die botschaft das hat das irgendwie alles okay ist oder nicht kaputt ist und es ist ja auch dieses.Das hat er tatsächlich funktioniert so alles was man sich vorher gedacht hat eine eventualitäten konnte man irgendwie ausgleichen es ist dabei nichts schief gegangen,und man ist jetzt eigentlich so völlig im modus also man,es ist ja im prinzip keine zeit verloren wurden die maximal denkbare bereitstellungsraum zeit sozusagen also wenn man nur sechzehn stunden hat will man ja jetzt nicht auch erstmalvier stunden damit verbringen ding erstmal in die richtige stelle zu bringen sondern er lag eigentlich schon.
Tra-Mi Ho 1:39:28
Dann,bei dem zweiten aufrichten mechanismus anscheinend in der richtigen in der richtigen lage aber es hat uns dann im verlaufe der zeit noch ein bisschen stutzig gemacht weil messgerät hat ja zwei antennen,zur redundanz das eine ist auf der oberfläche installiert die eine antenne und dann also die top-platz antenne und die bodenplatte antenne.
Tim Pritlove 1:39:54
Das egal wie man jetzt liegt.

Tra-Mi Ho 1:39:55
Dass er immer sozusagen funken kann das ist die drin und dann prinzip dahinter und da haben wir aber gemerkt dass die antennen,also mit mehr oder einfach gesagt die falsche antenne hat stärker funktioniert als sie richtige antenne,das hat uns schon stutzig gemacht und,wir wussten auch nicht ist es jetzt muss es so sein oder muss es nicht so sein und wir haben uns lange überlegt,das ganze diskutiert aber auch die jeans sensoren haben wir aber festgestellt dass das signal ein bisschen flach war.Durch die ganzen hauskeeping die daten die darunter gekommen sind ähm.Das hat er uns stutzig gemacht aber wir konnten uns noch,also wir hatten gedacht irgendwie kann es passieren dass doch der länder in der falschen position ist und schon jetzt angefangen hat seine wissenschaftlichen instrumente anzuschalten,da hat die jacke dann sehr schnell die kamera taten,uns geschickt und auch die daten des mikroskop und die haben wirklich dann festgestellt dass da streu lichter reingekommen ist und es gibt auf der falschen seite leer das heißt dass bei dem,ersten aufrichten manöver,signale sozusagen richtig interpretiert worden er sich aufgerichtet hat aber wieder in die falsche richtung gekommen ist aber er dachte er wäre richtig.Hat angefangen zu messen genau.
Tim Pritlove 1:41:39
Ok also doch alles gar nicht so einfach.
Tra-Mi Ho 1:41:41
Es ist nicht einfach.
Tim Pritlove 1:41:42
In dem moment okay streusel wo kommt das her.
Tra-Mi Ho 1:41:47
Die sonne die kamera lag.
Tim Pritlove 1:41:52
Verstehe und dann hat sie sich einfach geirrt weil es ist ja auch verdammt hell also man denkt ja dann immer so dunkel aber da ist kein nebel da sind keine wolken da knallt die sonne dann,voll rein und das ist ein problem mir ging's,dann weiter also man lag jetzt richtig jetzt konnten einfach daten gesammelt werden dann hüpft man es erstmal nicht weiter durch die gegend oder also jetzt muss es muss man ja auch entscheiden so okay was machen wir jetzt,guter masterplan gegeben haben aber jetzt ist ja die ist-situation erreicht worum ging es denn jetzt erstmal.
Tra-Mi Ho 1:42:33
Also es ging erst mal darum den länder in die richtige position zu versetzen das.
Tim Pritlove 1:42:40
Aber das war ja jetzt.
Tra-Mi Ho 1:42:41
Nein er weiß eben nicht er war ja sozusagen nicht und musste jetzt in die.
Tim Pritlove 1:42:46
Also man muss ja stimmt ja man muss jetzt nochmal korrigieren ok das heißt jetzt muss man nochmal schwung holen.
Tra-Mi Ho 1:42:48
Genau er er ist ja in der annahme dass er in der richtigen position liegt es war aber.
Tim Pritlove 1:42:56
Die autonomie hat sich in dem moment einfach abgeschaltet hat gesagt wieso was wollt ihr eigentlich.
Tra-Mi Ho 1:43:00
Was wollt ihr denn genau ist doch alles super jetzt fahre ich meine sequenzen schön brav durch und dann wenn die sequenzen also der ganze sciences vorbei ist dann heißt es ja das nächste ist ich springe nochmal und messe wo an.
Tim Pritlove 1:43:13
Verstehe das heißt man muss jetzt erstmal zwischen reingehen sagen moment du hast leider knick in der optik.
Tra-Mi Ho 1:43:18
Genau und das ist natürlich auch mit zeitverzug verbunden wieder dreißig minuten hin und zurück sozusagen um dann,ja und es ist letztendlich haben wir die autonomie haben wir dann unterwandert,wir haben den länder gesagt jetzt hör auf autonom zu arbeiten jetzt höre auf uns beende erstmal den zyklus so schnell wie möglich und richte dich nochmal auf.Das hat der länder dann auch gemacht das heißt es war ground command,von der erde aus und dann hieß es wieder vom von maske ja ich liege jetzt richtig jetzt fange ich an zum essen wieder.
Tim Pritlove 1:44:04
Also richte dich auf heißt ja eigentlich nur mach spielereien mit dem schwung.
Tra-Mi Ho 1:44:09
Schwung genau schwing deinen arm und bewege dich wieder.
Tim Pritlove 1:44:13
So schwingt dann irgendwie wie läuft denn das eigentlich also der der rotiert ja nicht einfach nur sondern man rotiert in die eine richtung und dann unterbricht man die rotation für einen kurzen moment oder so und dann und dann ich denke mal so oh jetzt müsste.
Tra-Mi Ho 1:44:25
Impuls in das system und dadurch dass wir so wenig gravitation auf dem asteroiden haben wir haben ja,zu einem zehntausende von der erde.
Tim Pritlove 1:44:38
Ein zehntausend okay.
Tra-Mi Ho 1:44:39
Genau,wird natürlich der impuls dann in diesen hüpf mechanismus in diesen dann übertragen und dadurch bewegt sich dann der astrid sich fort und auch da haben wir natürlich.
Tim Pritlove 1:44:54
Der länder nicht ein astrid der bleibt ja hoffentlich vorher ist.
Tra-Mi Ho 1:44:55
Ach gott der schuldige der astro.
Tim Pritlove 1:45:02
Okay also ergibt sich quasi selber so einen ruck und weil ihnen eben der astrid nicht nennenswert festhält schwimm wirbelt er sozusagen aber es,keine klare vorberechnet e also man berechnet jetzt diesen schwung nicht vor dass man,genau auf der anderen seite landet weil man weiß ja auch nicht so genau wo man dann sonst eher würfeln.
Tra-Mi Ho 1:45:25
Es ist ein würfeln.
Tim Pritlove 1:45:26
Man hat so einen würfel mit zwei seiten und man würfelt ihn immer wieder und die wahrscheinlichkeit dass man irgendwann auch mal wieder auf der richtigen seite landet steigt.Hast du beim ersten mal schon funktioniert.
Tra-Mi Ho 1:45:37
Es hat dann funktioniert.
Tim Pritlove 1:45:39
Beim ersten mal auch.
Tra-Mi Ho 1:45:40
Beim ersten mal ja nicht.
Tim Pritlove 1:45:42
Bei der beim ersten mal den.
Tra-Mi Ho 1:45:43
Nach dem nach.
Tim Pritlove 1:45:44
Man festgestellt hat dass es dass er falsch geguckt hat.
Tra-Mi Ho 1:45:47
Ja das hat funktioniert dann ja also die er hat gemessen aber auch da müssen wir natürlich erst mal feststellen ob das die daten.
Tim Pritlove 1:45:55
Wieder streubt sich dabei ist.
Tra-Mi Ho 1:45:56
Nicht streut oder ob er wieder mit den jeans entsorgen sich das falsch interpretiert hat und auch da müssen wir wieder abwarten aber es wird dann die ersten bilder bekommen haben von dieser asteroiden oberfläche da haben wir doch alle aufgeatmet.
Tim Pritlove 1:46:11
Und man hat auch vor allem auch gesehen dass jetzt die richtige antenne das bessere signal hat.
Tim Pritlove 1:46:15
Das war ein interessanter das war wahrscheinlich so eine korrektur die so vorher noch gar nicht drin war oder also die autonomie hätte ja sagen können,ok lage sind sogar alles schön und gut aber wenn die antenne schwächer ist dann kann das ja nicht wahr sein das war so nicht vorgesehen dass quasi der erkenntnis die erst in dem moment kam.
Tra-Mi Ho 1:46:35
Die kam danach obwohl ich.Ich denke mir dass wir verschiedene messmer zeiten eingefügt,es ist ja so man muss sich auf ein signal verständigen und so viel auto also so intelligent ist der länder nicht dass er sozusagen eine abwägung machen kann,sagen kann okay auf welches signal konzentriere ich mich dann eher also man kann ihm nur sagen konzentriere dich erstmal auf dieses signal das ist,erste das primär signal das musst du interpretieren und die anderen dass sie nur sekundäre falls du ausfallen solltest wir haben uns auf unsere,ps sensoren verständigt dass das die ersten zehn toren sind die das festlegen ja.
Tim Pritlove 1:47:22
Danach weiß man es immer besser wo ist die künstliche intelligenz wenn man sie mal braucht.Ja dann kommen wir doch mal zu den zu den eigentlichen daten die hier gewonnen wurden was was könnte denn jetzt von maske herausgefunden werden.
Tra-Mi Ho 1:47:41
Von messgerät wurde herausgefunden dass die oberfläche des asteroiden gar kein staub hat,wir haben ja damit gerechnet dass irgendwie staub in irgendeiner form vorhanden ist.
Tim Pritlove 1:47:59
Also sehr leichte dünne partikel die so vielleicht auch ein bisschen rumfliegen.
Tra-Mi Ho 1:48:03
Ja genau also das scheint nicht der fall zu sein dass da wirklich reguliert partikeln auf der oberfläche zu finden ist ähm.
Tim Pritlove 1:48:15
Das heißt er ist quasi frisch gesaugt und nur stein.

Tra-Mi Ho 1:48:18
Nur stein genau dann hat die kamera auch festgestellt dass es zwei arten,von gesteine n gibt es gibt gesteinsbrocken die sind sehr kantig geschnitten und sehr scharf geschnitten und auch heller,und es gibt wiederum die andere art von gesteine die sind ein bisschen krümelige,sehen aus wie wie brokkoli sozusagen wie brokkoli ja sie nennen es auch colly flower structure.Und das,sagt auch etwas aus dann über vielleicht die entstehungsgeschichte von von rico vielleicht ist es so dass er nur einmal in seinem,seine entstehung oder auch mehrmals durchgerüttelt wurde und dadurch dann vielleicht auch verschiedenebereiche sozusagen aufgeschüttelt wurde ja es ist ja nicht so dass auf der oberfläche ist nur auf dieser stelle dieses gestein zu finden ist und auf der anderen stelle ist nur das also es ist wirklich alles so ineinander gemischt,das kann aufschlüsse geben über die entstehungsgeschichte des asteroidenwas wir auch festgestellt haben ist dass der asteroid wahrscheinlich sehr porös ist und auch sehr dunkel ist.Aber auch hart und einer der kollegen meinte es ist sowas wie braunkohle,der ist am anfang genannt,dunkel und porös aber hart aber dann hat er gemeint vielleicht wenn man das so bildlich sich vorstellt ist es doch eher so was wie so feste aschesozusagen die die zusammensitzt gesetzt hat also nicht kohle mäßig sondern mehr so feste asche.
Tim Pritlove 1:50:18
Das heißt auf einmal ist auch der übergang zwischen komet und astrid sehr viel.
Tra-Mi Ho 1:50:22
Ja genau es scheint so eine art.
Tim Pritlove 1:50:27
Ist dann ok das heißt der komet zumindest wenn man jetzt die beiden körper miteinander vergleicht ist im kern sind sie sich sehr ähnlich nur dass der komet noch irgendwas.Was hat in der sonne im verdampft und deswegen gibt es diesen kommenden schweif.
Tra-Mi Ho 1:50:45
Dann haben wir auch die temperatur messen können die temperaturverlauf auf der oberfläche des asteroiden und.Dadurch dann auch.
Tim Pritlove 1:51:02
Dieser tages-nachtzeit.
Tra-Mi Ho 1:51:04
Die tagesform hilfreich.
Tim Pritlove 1:51:04
Ganz hilfreich weil man will ja nicht nur messen wie warm es ist jetzt gerade sondern wie verändert sich das wie schnell kühlt es ab wie schnell wird es wieder warm.
Tra-Mi Ho 1:51:12
So ist das und mit dieser temperaturverlauf kann man dann auch eine relation dann bilden gibt es da den ähnlichkeit zu dem meteoriten die wir gefunden haben auf der erde,was auch die kollegen dann festgestellt haben an den kamera bildern auch das innen gestein ist so helle kleine punkte gibt die sie inklusions nennen und solcheeinlagerung so helle mineralischeeinlagerung sind auch in manchen meteoriten sammlungen wiederzufinden in und auch,das verhalten der temperatur sozusagen des asteroiden ähnelt sehr den von bestimmten meteoriten die auf der erde gefunden wurden,das heißt natürlich nicht dass diese meteoriten auch wirklich dann von ruhig zu stammen sondern dass es da wahrscheinlich ähnliche.Parent bodies also.
Tra-Mi Ho 1:52:14
Ursprünge geben kann.
Tim Pritlove 1:52:16
Also das hier sozusagen aussehen aus derselben quelle mal auseinandergebrochen sind oder sich zumindest im gleichen zeitraum gebildet haben im selben bereich.
Tra-Mi Ho 1:52:23
Mindestens oder im im bereich.
Tim Pritlove 1:52:29
So die uhr tickt sechzehn stunden sind dann irgendwann rum und dann ist das ding stumm und das war's.
Tra-Mi Ho 1:52:40
So ist das.
Tim Pritlove 1:52:41
Ist das zum raumfahrt business.
Tra-Mi Ho 1:52:44
So ist es.
Tim Pritlove 1:52:46
Okay das kam jetzt zumindest nicht unerwartet aber man war der zumindest schon froh schon nochmal eine stunde rausgeholt zu haben das heißt alle einschätzungen haben auch ganz gut gestimmt und dann ist irgendwie ruhe und jetzt liegt er da rum.
Tra-Mi Ho 1:52:58
Wir haben das nicht miterlebt also wir haben im team natürlich meinten wir denn es ist für uns natürlich messgerät ist so für uns natürlich wie wie,das ist ja fast schon lebendig für uns,das baby sozusagen da hatten wir auch dann gemeint er hat sich ja verabschiedet also er hat,die batterien sind noch nicht ausgegangen als er noch mit uns oder der länder mit uns kommuniziert hat sondern die kommunikation ist dann abgebrochen als die nacht,angesprochen ist und.
Tim Pritlove 1:53:36
In der nacht.
Tra-Mi Ho 1:53:38
In der nacht ist er sozusagen.
Tim Pritlove 1:53:39
Im schlaf verschiedene.
Tra-Mi Ho 1:53:41
Ja genau also das haben wir nicht erlebt ja.
Tim Pritlove 1:53:52
Was bleibt dann,übrig also jetzt wenn man jetzt die technische leitung hatte und das gerät ist dann irgendwie aus dann ist es ja eigentlich auch erstmal vorbei so,aber man hat wahrscheinlich noch 'ne ganze menge daten an denen man dann noch im rückblick neue erkenntnisse gewinnen kann für künftige planungen solcher mission oder.
Tra-Mi Ho 1:54:13
Ja also man hat viele daten und man denkt sich in dem moment ach jetzt würde ich es noch anders machenund jetzt würde ich dem länder zwei schwung arme geben und man kann auch länger leben lassen wenn man das und das und das berücksichtigt natürlich also es ist sehr viel an an lessons learnedgemacht worden durch die mission wo man sagen kann okay da sind wir vieloptimierungsmöglichkeiten um solche missionen dann noch robuster zu machen oh da gibt's noch viele wissenschaftliche fragestellungen die sind interessant und die würden wir gerne auch nochwollen ja.
Tim Pritlove 1:54:59
Jetzt,war natürlich die mission selber noch nicht ganz vorbei dann kam es damals schon mehrfach drüber gesprochen noch dazu dass eben seine proben genommen hat das hat also hayabusa zwei noch seine proben genommen hat das hat dann gut funktioniert.
Tra-Mi Ho 1:55:17
Das hat sehr gut funktioniert sie haben zwei proben entnommen also an zwei stellen haben sie proben entnommen.
Tim Pritlove 1:55:25
Und das war dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als beim ersten mal oder.
Tra-Mi Ho 1:55:30
Also es scheint so als ob es mehr ist und ja man weiß ja nur wenn man die dose geöffnet hat ja,aber es scheint,ob die proben entnahme sehr erfolgreich war und das interessante ist ja auch dass bei zwei die kollegen die japanischen kollegen ja einen künstlichen krater,gemacht haben auf der oberfläche durch einen explosiven impacto und sie dann in der region dieses krater sozusagen in der nähe dann die proben entnommen haben vielleicht,dann auch proben.
Tim Pritlove 1:56:11
Also um mehr zu haben oder auch um tiefer zu geh.
Tra-Mi Ho 1:56:14
Tiefer zu gehen man muss natürlich sich anschauen inwieweit wirklich man dann proben entnommen hat die die auch von der tiefe gekommen sind.
Tim Pritlove 1:56:25
Das wird sich dann alles noch zeigen ich glaube ende dieses jahres ist dann die rückkehr geplant.Also rückflug dauert jetzt quasi noch mal so ein so ein jahr.Das sind normale solche zeiträume und der rückflug ist aber schon eingeleitet hatte ich vorhin ja schon erwähnt also seit november sie jetzt seit zwei monaten ist es zwei quasi auf dem,rückweg dann kommt die sonne an und dann gibt's wahrscheinlich nochmal eine große party oder vom ganzen team.
Tra-Mi Ho 1:56:53
Vom ganzen team ja in japan genau.
Tim Pritlove 1:57:00
JaHaben wir noch irgendwas vergessen zu erwähnen auf dass man nochmal eingehen sollte also ist ja jetzt auch es gibt ja auch noch andere missionen die jetzt von anderen organisationen angestrebt werden ob ich die nasa.
Tra-Mi Ho 1:57:19
Zeitgleich aus siris rex benny.
Tim Pritlove 1:57:23
Also das ist jetzt sozusagen die sind jetzt auf den geschmack gekommen jetzt wollen sie jetzt auch.
Tra-Mi Ho 1:57:27
Benötigt auch also ist ja zeitgleich mehr oder weniger an von ihre freaks besucht worden oder ist aus ihres rex ist ja noch immer bei benny wie zwei und rückruf,das war ja schon also da,gibt es auch intensiven austausch zwischen der jagd und der nasa kollegen wie wie die lessons learned dieser zwei mission sind und auch informationen derjackfruit kollegen bezüglich des der ernährungsweise das ist ganz ganz wichtig auch für die andere mission wie ja,was man da raus für erkenntnisse bekommen kann.

Tim Pritlove 1:58:16
Ja es wird dann vor allem interessant sein zu sehen wie die wissenschaft jetzt daraus zehren kann wenn ihr innerhalb kürzester zeit von zwei solchen kohlenstoff asteroiden also von denen am meisten zu finden sind offenbar,in unserer umgebung jetzt die daten zurückkommen und wann daraus schlüsse ziehen kann was ist da so ihre erwartungen wozu,also es ist ja immer immer schwierig ich weiß nahezu unmöglich eigentlich vorher zu sagen was was die erkenntnisse sind man weiß es ja nicht so aber wir hatten ja am anfang so ein paar ziele formuliert so dieses mysterium wo kommt das wasser her oder wie genau,was hat sich jetzt eigentlich aus was herausgebildet sind die asteroiden eigentlich auch nur so ein,weiteres endprodukt oder sind sie letzten endes die zeugen der urs suppe unseres sonnensystems das sind ja im wesentlichen so die fragestellung die so im,raum sind ich könnte mir vorstellen die kollegen vom vom drk in berlin von der planetenweg forschung die haben schon ganz feuchte finger.
Tra-Mi Ho 1:59:18
Alsowenn wir jetzt auf benny und ruhig gut zu sprechen kommen dann wenn man die beiden miteinander vergleicht ist ist ja sticht es ja ins auge dass sie sich sehr ähneln das sind ja fast zwillingebeide sind top shape asteroiden typ steroiden und wenn man sich die oberfläche anschaut dann ist es auch bemüht sehr sehr voller gesteine ähm,der unterschied ist aber beim benny interessanterweise ist dass die nasa kollegen ja,staub um den asteroiden herum entdeckt haben also staub welches um den asteroiden fliegt was vielleicht auf eine,fragezeichen hindeuten.
Tim Pritlove 2:00:02
Oder einfach nur schlecht gesaugt.
Tra-Mi Ho 2:00:04
Noch schlecht getaugt ja also das ist schon sehr interessant und da kann es gab auch,im november zweitausendundachtzehn,vor einigen monaten gab es auch das erste meeting dazu um diese wissenschaftliche,mal nebeneinander zu stellen und festzulegen wo ist denn da die ähnlichkeit des asteroiden und wo sind,der beiden asteroiden wo sind da die unterschiede also so eine art vergleichende wissenschaft workshop wurde dadurch geführt also.Ich war leider nicht dabei aber ich glaube da ist wirklich ganz viel interessantes rausgekommen.
Tim Pritlove 2:00:50
Macht aber auch wieder schön klar,dass er jetzt zwei getrennte missionen von zwei verschiedenen organisationen gruppen geführt wurden heißt nicht dass man da jetzt irgendwie im wettbewerb ist sondern ganz im gegenteil,das heißt einfach man hat noch mehr daten und noch mehr vergleichsmöglichkeiten und die wissenschaftler teams die daran arbeiten arbeiten ohnehin global und arbeiten natürlich in dem moment auch zusammen an solchen sachen.
Tra-Mi Ho 2:01:14
Genau ja ja also das ist etwas was in der wissenschaft welt glaube ich nichtan dem es kein zweifel gibt das umso mehr datenbank hat umso mehr man daraus was ableiten kann und erkennen kann und da ist gerade diese zusammenarbeit auch auf internationaler ebene wird das sehr forciert.Das macht natürlich die co-autoren liste der papers länger,ich glaube wenn es nur das ist.
Tim Pritlove 2:01:48
Ja vielen vielen dank für die ausführungen hier zur hayabusa zwei und natürlich vor allem zu dem aspekt des mascot lenders die wir hier erhalten haben.
Tra-Mi Ho 2:01:59
Ja sehr gerne.
Tim Pritlove 2:02:01
Und mir bleibt jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen insofern sage ich auch vielen dank fürs zuhören hier bei raum zeit bald geht's wieder weiter wie immer ich sage tschüss und bis bald.
Shownotes
Erkenntnisse aus den Lander- und Rovermissionen zum Mars der letzten Jahrzehnte
Der Mars ist und bleibt das interessanteste Objekt der Raumfahrt. Alle zwei Jahre starten neue Missionen zu unserem Nachbarplaneten und senden neue Sonden, Lander und Rover ab, um weitere Erkenntnisse über Geologie, Geochemie und andere Aspekte zu gewinnen. Denn das Wissen um Geschichte, Aufbau und Struktur des Mars liefern eine Menge Informationen über die Entstehung des Sonnensystems und damit auch neue Erkenntnisse über die Erde. Die extrem erfolgreichen und auch gut aufeinander abgestimmten Missionen der NASA und ESA der letzten Jahrzehnte haben uns nun ein interessantes Instrumentarium, um diese Erforschung weiter voranzutreiben und neue Missionen sind bereits in den Startlöchern. In dieser Ausgabe von Raumzeit schauen wir, was die bisherigen Missionen geleistet haben und was wir dabei über den Mars gelernt haben.
Dauer:
2 Stunden
7 Minuten
Aufnahme:
09.11.2019

Susanne Schwenzer
|
Susanne Schwenzer wollte eigentlich Journalistin werden, hat sich dann aber doch für die Mineralogie entschieden und wirkt heute nach Stationen beim Max-Planck-Instititut für Chemie in Mainz und in den USA als Senior Lecturer an der Open University in Milton Keynes in England. Susanne Schwenzer ist früh mit den Ergebnissen der Marsforschung in Kontakt gekommen und ist jetzt Teil der Science Teams verschiedener Marsmissionen einschließlich des Mars Science Laboratory (Rover Curiosity) der NASA und der kommenden Missionen ExoMars (ESA) und Mars 2020 (NASA).
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript
mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert.
Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern.
Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort.
Formate:
HTML,
WEBVTT.
Transkript
Tim Pritlove 0:00:35
Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten mein name ist Tim Pritlove und ich begrüße alle zu nummer zweiundachtzig unserer gesprächsserie über.alles was die welt so bewegt.Und heute ist mal wieder so ein besonderer tag weil ich habe mich mal ganz weit aus meinem studio weg entfernt und hab die reise angetreten nach england konkret befinde ich mich jetzt.Milton jeans an der open versinkt y.Und das habe ich gemacht um mal über den maß zu sprechen wir haben schon mal bei den maß gesprochen über den mars als solchen was dort alles so ist auch bei maß express die elsa mission die wir hier schon mal ein thema,aber heute möchte ich mich konkreter auf all die dinge.Konzentrieren die dort am boden stattfinden über die rover sprechen und was dort für wissenschaft betrieben wird und dazu begrüße ich zunächst einmal meine gesprächspartnerin mich doktor susanne schlenzer hallo schönen guten tag.
Susanne Schwenzer 0:01:42
Hallo vielen dank.
Tim Pritlove 0:01:43
Herzlich willkommen zur raum zeit ja frau schmelzer sie sind gelogen richtig.
Susanne Schwenzer 0:01:52
Mineral login genauer gesagt aber ich gehe auch als biologe durch denn das kann man so ja nicht ganz genau trennen ich habe mineral energie in mainz studiert ähm mit dem schwerpunkt georg chemie und thermodynamik.Und dann auch in mainz meine doktorarbeit gemacht da max bank institut dort über maß meteoriten und.
Tim Pritlove 0:02:12
War das schon immer ihr ziel so wissenschaftlerin zu werden.
Susanne Schwenzer 0:02:15
Eigentlich nicht nein eigentlich wollte ich journalist werden und heute vielleicht auf der anderen seite sitzen und äh jemanden interviewen aber die maß meteoriten hamstern geschafft und habe mich für die wissenschaft eingefangen.
Tim Pritlove 0:02:29
Wie kriegt man denn da die kurve also.
Susanne Schwenzer 0:02:31
Durch die begeisterung durch das was sie erforschen können und letztlich als journalistmöchte man dinge herausfinden und möchte man hintergründe erkundenund als wissenschaftler möchte man das auch und als ich begonnen habe für meine die situation zu arbeiten und äh festgestellt habe was manam mars alles erforschen kann die faszination der raumfahrt entdeckt habe und für mich entdeckt habe dann war es irgendwie und dann hab ich gedacht naja kannst du vielleicht noch eine poste stelle irgendwo annehmen unddann ist es so weitergegangen.
Tim Pritlove 0:03:09
Das heißt die entscheidung für mineral logi e stand schon nach der entscheidung auch konkret sich auf die raumfahrt und die erforschung des all zu konzentrieren oder war das dann eher nach.

Susanne Schwenzer 0:03:21
Das eigentlich wollte ich ähm gleich journalist werden aber dann hat mein vater so gesagt naja wenn du nicht irgendwie nur im lokal journalismus hängen bleiben möchtestaber sondern wenn du wirklich den großen journalismus machen willst dann.Die ganzen lebensläufe an die leute haben alle irgendwie ein studium absolviert,na ja gut dann gucken wir uns mal an dann mache ich erst bei geschichte aber das hat mich dann doch nicht so interessiert und dann hab ich die chemie für mich,aber da ich zu den geburtenstarken jahrgänge gehört habt dann waren die chemie häuser voll bis zum.Und dann bin ich in den app wissenschaften gelandet mein vater war geologie meine mutter geographic bin bin ich so mal an einem tag der offenen tür der uni mainz zu den georg wissenschaftlern gegangen und fand das einfach total fasziniert.Eigentlich habe ich immer gesagt ich wollte will das nicht machen weil möchte ich wirklich jedes mal am wochenende nach hause kommen und gefragt werden und was habt ihr die woche gemacht von eltern dies jahr in dem zudem im moment besser wissen na ja aber dann habe ich die mineral energie gesehen und fand das einfach so faszinierend und so spannend dass ich gedacht habeigentlich na ja wenn sie zu viel fragen brauchst du auch nicht nach hause zu gehenaber es war da nie so wir haben uns wunderbar unterhalten denn das was wir gelernt haben in der mineral energie das hat meine eltern ja nur endlich mit.Und meine eltern wussten dinge die ich so nie gelernt habe weil man kann ja nicht alles machen in paar jahren studium und so bin ich zum mineral gekommen und habedann beschlossen ich äh promovieren auch noch hab nebenbei schon journalismus gemacht bei der rhein zeitung in mainz gearbeitet auch viel ehrenamtlich journalismus gemachtzehn jahre für den verein lahn marmor museum äh die zeitschriftbetreut und auch meditiert habe also sehr viel als journalist gemacht während meinem studium und auch noch während meiner doktorarbeit und bin dann aber während derarbeit irgendwie immer mehr dazu gekommen dass meine berufung dann doch irgendwas sabor ist und die zahlen und das wirklich herausfinden von dingen und das weitergeben von leuten gemacht werden kann die das,können als ich und die da mehr talent haben als ich.
Tim Pritlove 0:05:22
Was ist denn so faszinierend an mineral logi e.

Susanne Schwenzer 0:05:26
Genau wie die physik die chemie erklärt die mineral logi e,zusammenhänge im weiteren bereich auch mineralöle brauchen sie als bau materialien mineralöle sind die grundlage einer umwelt.Es ist zum beispiel ein unterschied ob sie sagen wir mal auf dem.Stehen wo sie bei salzige steine haben oder im schwarzwald wo sie granit gestein haben weil die andere chemische zusammensetzungen haben deshalb werden die böden anders deshalb sind diepflanzen andere selbst wenn sie an einer stelle wären wo temperatur und niederschlags menge und alles dasgleiche wäre die steine bilden ihnen die chemie und die steine sind aus mineralien zusammengesetzt sie haben also dort eine.Grundlage dessen was einen bestimmten ort ausmacht aber sie haben auch die mineral logik als material wissenschaft wenn sie eine,armbanduhr nehmen die batterie betrieben ist dann haben die heißen alle quarz ohren weil es da ein zu elektrischen quarz kristall drin hat der dafür sorgt dass die uhr eine uhr ist weil er eben in einem bestimmten rhythmus schwingt und damit die uhr gehen lässt.Und das alles ist die mineral logik zement ist mineral energie alles was sie in organischen materialien erstellenist letzten endes mineral energie.Außerdem ist die symmetrie der mineralöle auch faszinierend und fast schon künstlerisch also es ist ein sehr weites feld das da faszination auslöst.
Tim Pritlove 0:06:53
Und wie kriegt man den sprung von den mineralien zum weltraum.

Susanne Schwenzer 0:06:59
Ich habe mich sehr stark für analytic interessiert und auch chemie georg chemie gemacht ähm und in meinem grund studium.Und auch meine diplomarbeit war 'ne massen spektrum metallische arbeit und dann hab ich mich nach der situationen umgesehenund dann war gerade zu dem zeitpunkt aussehen ein großes thema was auch analytisch sehr stark eingebunden war aber.Das thema was sich dann zufällig entdeckt habe solche dinge sind ja ganz oft zufall ich hab mich nachstellen umgesehen hauptsächlich im bereich georg chemie ich wollte in die umwelt gehe chemie aussehen war ein themaandere schwermetalle war ein thema und dann plötzlich in all den stellenanzeigen ihr kommt eine stellenanzeige raus die sagt edel gase in mars meteoriten.Ist eine sehr seltene technik ist etwas was ich noch nie gemacht hattealleine hat mich schon fasziniert aber wenn dann die stellenanzeige sagt es ist eine max bank institut.Da wissen wir alle dass das eben ein forschungs- institut ist wo man mit sehr vielen extrem guten leuten zusammenarbeiten kann und da habe ich gedacht na ja du schreibst meine bewerbung wirst du nie kriegen,na ja es ist anders gekommen und zum glück anders gekommen.
Tim Pritlove 0:08:14
Und das war dann in mainz.
Susanne Schwenzer 0:08:17
Das war in mainz am max bank institut in mainz zeit als denke und b mann noch direktorin waren also keine schwenke noch direktor war und dann ähm unter druck meier auch.
Tim Pritlove 0:08:30
Das heißt wir sprechen jetzt von ende der neunziger jahre miteinander ja.
Susanne Schwenzer 0:08:34
Ich ende der neunziger jahre ich hab zweitausendvier mein abschluss gemacht.
Tim Pritlove 0:08:38
So und da ging 's ja dann auch auf maß schon heiß her.
Susanne Schwenzer 0:08:44
Ja ähm ich war im grund studium noch dann hat er hat das max blank institut des instrument aufpass finde geschickt und das hab ich nur am rande mitbekommen ich war am max bank institut als ähm hey wie man so schön sagt ab und zu tätig steine klein machen solche sachen hilfst arbeiten eben aber das bekommt man natürlich mitda sind dann seminare und dann sind plötzlich auch bei haufenweise journalisten da wenn irgendwas gerade aktuell istaber die hauptsache für mich war halt zum einen zu sehen was die kollegen machen die daten die die kollegen zurückbekommenirgendwelche dinge zu sehen zu erforschen die so noch nie jemand gesehen hat das war eigentlich eine der grundlagen.
Tim Pritlove 0:09:33
X ist das alpha partikel spektrum meter auf der marktpassage mission der nasa die dann sozusagen dafür verwendet wurde dort die chemischen elemente zu untersuchen nämlich alle.
Susanne Schwenzer 0:09:46
Das ist eine analyse die sie da machen.Und diese gestein analyse ist sehr vergleichbar mit dem was wir hier auf der erde machen würden und sie können damit eben das gestein als solches bestimmen und damit auch wieder die umweltbedingungen bestimmen.
Tim Pritlove 0:10:04
Das heißt das hat man so mitbekommen weil weil es quasi in mainz gab es eine abteilung die sich mit diesem instrument instrument gebaut hat oder okay.
Susanne Schwenzer 0:10:15
Rudolf frida und ralf gelernt haben das instrument gebaut in mainz und dann eben wurde es von der nasa in den oberen integriert.
Tim Pritlove 0:10:26
Der rosa war der jona.
Susanne Schwenzer 0:10:30
Zuerst desto journal das ist auf dem turnier geflogen das ist auf den mars expression rover spirit and opportunity geflogen und es ist jetzt auf m s l.
Tim Pritlove 0:10:42
So was braucht man einfach.
Susanne Schwenzer 0:10:44
Man braucht ein instrument das genaue gescheites chemie liefert und das objekt ist eines von vielen instrumenten das gedauert gestein chemie liefert.Auf dem mars zwanzig zwanzig dem in der zukunft ist es nicht mehr drauf es ist nicht auf jede mission geflogen aber auf diesen robert mission ist es geflogen ich kann mir aber durchaus vorstellen dass es in zukunft auch mal wieder fliehen.
Tim Pritlove 0:11:06
Okay aber damit hatten sie jetzt sozusagen erstmal am anfang nichts mit zu tun mit diesem instrument das fand nur statt und man kriegt ihr das so mit und das wahrscheinlich ein bisschen ins gespräch.
Susanne Schwenzer 0:11:15
Das war das gesprächsthema das war das thema viele seminare dann kommen natürlich internationale kollegen die doch im labor arbeiten die dort im labor zu gange sind und die dann auch vorträge halten man bekommt es also danndeutlicher mit als man es mitbekommen würde wenn man jetzt nur an der universität ist dadurch dass ich eben auch äh am max bank damals schon als assistent gearbeitet hab undman bekommt die die faszination der erforschung hautnah mit.
Tim Pritlove 0:11:45
Aber dann hat es nicht in mainz gehalten lange also.
Susanne Schwenzer 0:11:49
Relativ lange aber dann auch wieder nicht lange ich hab nachdem ich meine die situation abgeschlossen hatte noch drei jahre in mainz weitergearbeitet an den themen die ich während meiner die situation bearbeitet hab hauptsächlich edel gase in maß meteoritaber auch edel gas fraktionen näherung also was passiert wenn atmosphäre und steine in kontaktkommen was bleibt am gestein haften was wirdabsolviert um das dem fach ausdruck zu benutzen und was eben nicht und welche veränderungen finden da statt das war mein forschungsgruppe.
Tim Pritlove 0:12:23
Du musst keine fragen maß meteoriten darin wir jetzt von gestein was vom maß kommt aber es auf die erde geschafft hat oder okay.
Susanne Schwenzer 0:12:31
Also meteoriten generell ist ja extra restliches material das von irgendwo anders aus der erde kommt und hier auf der erde landet.
Tim Pritlove 0:12:40
Da frage ich mich halt immer woher weiß man denn dann das vom maß kommt.
Susanne Schwenzer 0:12:43
Für die maus meteorit ist die mission entscheidend denn bikini neunzehnhundert.Ich hat ein massen spektrum meter gehabt und hat die zusammensetzung der maß atmosphäre gemessen.Und die krypton verhältnisse die damals gemessen worden in der maß atmosphäre stimmen mit denen überein die in die in den.Impakt gläsern also glas material in diesen meteoriten eingeschlossen sind man kann natürlich auch andere.Dinge.
Tim Pritlove 0:13:18
In parkhäusern dadurch dass es in die atmosphäre eintritt und durch die einsetzung bildet sich sozusagen diese gläser beim eintritt.

Susanne Schwenzer 0:13:26
Die gläser bilden sich bereits auf dem mars wenn sie einen anschlag karte haben dann haben sie dann wird ja die gesamte energie des.Deals das.Diese planeten oder sommer planeten oberfläche auftritt trifft wird ja die gesamte genetische energie wird dann im prinzip in wärme umgewandelt das heißt sie wenn der einstiegs körper groß genug ist schmelzen sie.Größere mengen gestein und haben dann in diesem geschmolzenem bereich was was.Passiert ist dieses projektil trifft auf die oberfläche und dringend solange in die oberfläche ein bis die gesamte kinetische energie aufgebraucht ist und was dann passiert ist mit einer explosion zu vergleichen.Wenn sie im plakate ähm von ihrer motto logi e vergleichen wollen ist es nichteine delle die wie durch einen hammer schlag passiert sondern das können sie am besten vergleichen mit den atombomben test geraten die passiert sind wenn sie also eine sehr große menge energie unterunter der oberfläche freisetzt.Das passiert dann und dadurch wird sehr viel material heraus geschleudert und damit können material so stark beschleunigt werden dass es einen planeten verlassen kann das passiert auf allen planeten auch auf der erde und in.Praktisch ins welt in den weltraum hinaus gelangt und was jetzt.Die maus meteoriten sehr viel häufiger macht als meteorit zum beispiel von der venus ist die einfache tatsache dass.Mars weiter draußen im sonnensystem ist als diedie erde das heißt wenn die auf irgendeiner beliebigen umlaufbahn sind ist die natürlich nicht stabil das größte gravitationswellen im sonnensystem ist die sonne selbst das heißt die werden so langsam aber sicher nach innen migriert und irgendwann diekreuzen dann treffen sie auf die erde die ja auch wieder ein gravitationswellen hat und werden dann entweder durch eine direkteder kollision oder auch dadurch eine gravitation ablenkung in richtung erde gezogen.Natürlich sonst viele auch nicht aber die die eben der erde nahe genug kommen können kollidieren können auf der erde landen und da finden wir sie dann.
Tim Pritlove 0:15:35
Aber wenn man jetzt so ein stein irgendwo rumliegen sie dann fällt mir da steht er nicht drauf liebe grüße vom mars sondern ich war ja auch erstmal auf die idee kommen sich das genauer anzuschauen.

Susanne Schwenzer 0:15:44
Genau und dann kommt man auf die idee sich das genauer anzuschauen entweder weil man ihn hat fallen sehen nie war einer der ersten meteoriten die man überhaupt hat fallen sie ist einer der mars meteoritenachtzehnhundert zwölf dann glaube ich mal aber legen sie mich nicht genau auf die zahl fest das heißt sie sehen den fallen und finden ihn oder sie sehen ihn zwar nicht fallen aber er hat,diese schwarze schmelz kruste die sie gerade beschrieben haben denn beim eintritt in die erdatmosphäre wird ja auch wieder sehr viel hitze freigesetzt und dann haben sie die schmelz kruste die aber nur die aller äußersten millimeter,und schmilzt und viel wird davon auch einfach applaudiert und kommt nie auf den boden an,aber das was auf den boden ankommt hat halt diese wenigen millimeter glänzender schwarzer kruste außen.Die verwittert mit der zeit und dann haben sie beim meteoriten wenig glück weil die sehen aus wie graue beiseite auf der erde und sollten sie aber dennoch finden dass der hier nicht hingehört und könnte was anderes sein dann müssen sie mit ins labor nehmen.Sehen mit ins labor nehmen dann machen sie georg chemie dann kommt in die großen instrumente alle zum tragen denn zum einen sind einige element verhältnisse anders maus hat zum beispiel im durchschnitt im verhältnis mehr eisen.Als magnesium das eisen magnesium verhältnis ist anders in maus gestein als es das interesse zwischen gestein ist das heißt das ist schon mal ein erster hinweis aber wirklich äh diagnostisch wie man so schön sagt,die edel gase wo sie direkt vergleichen können diese die gase die aus diesem glas materialien kommen die beim.Einschlag auf dem mars der diesen meteoriten quasi heraus geschleudert hat eingeschlossen worden sind mit der maß atmosphäre die in,die walking mission gemessen hat.
Tim Pritlove 0:17:34
Und an diesen eleganten da die in der regel mit nichts groß reagieren die sind dann halt einfach weniger unverändert dadrin und sind so ein klares zeugnis von wo es herkommt.
Susanne Schwenzer 0:17:45
Das können sie messen und zwar ist es insbesondere das iso topen verhältnis ich gehe mal davon aus dass einige hörer auch schon öfters mal das wortgehört haben das ist das hundertneunundzwanzig zehn verhältnis zum hundertzweiunddreißig zehn und das hier in der erdatmosphäre ungefähr eins ist und auf dem mars zwei komma sechs und das ist halt ein riesengroßer unterschied fürmessungen den man ganz ganz eindeutig messen kann.
Tim Pritlove 0:18:10
Das heißt man kann sich dann auch richtig sicher sein dass man hier ein stück maß in der hand hält und die ging dann alle über ihren tisch oder wie.
Susanne Schwenzer 0:18:18
Damals gab es genau neun und ich hatte alle neun.
Tim Pritlove 0:18:21
Wirklich.

Susanne Schwenzer 0:18:24
Und das ist schon ein ganz besonderes gefühl denn manche sind sehr sehr selten da gibt die sind halt sehr klein und sie sind sehr selten andere sind größer inzwischen haben wir über hundert und ich habe sie lange nicht alle in der hand gehabt.Und der rasante anstieg an meteoriten generell und dann natürlich auch den besonderen meteoriten,kommt halt dadurch dass insbesondere in den heißen wüsten marokko und so weiter aber auch chilli leute immer mehr gehen und suchenund wenn sie dort in diesen sand wüsten steine finden es ist zwar nicht hundert prozent sicher dass es ein meteorit ist aber die wahrscheinlichkeit ist halt extrem viel größer als wenn sie,irgendwo in deutschland danach suchen würden und wenn sie in deutschland in basalt-adler den regionen wie sagen wir mal der eifel oder den vogelsberg nach maß meteoriten suchen,die würden sie nieweil die sehen halt einfach so aus wie das gestein drumherum auch es sind bei salt und da kommt jetzt wieder die geologie und die mineral energie zum tragen das sind dieselben mineralöle das sind ist dieselbe chemie mitkleinen unterschieden aber die unterschiede sind nicht groß genug um visuell einen unterschied zu machen von dahersie das mit dem bloßen auge draußen im gelände nicht unterscheiden außer sie sind an einer gegend wie zum beispiel in der wüste oder auch der antarktis wo man eben steine leichter,und auch genau weiß was da vorkommt und das sehr anders ist von dem was sie eigentlich suchen.
Tim Pritlove 0:19:50
Das heißt es gibt doch richtig so hobby stein sammler also jetzt nicht unbedingt wissenschaftler so einfach leute die so.
Susanne Schwenzer 0:19:56
Hobby stein sammle auch viele ähm der lokalen bevölkerung die das dann nicht als hobby sondern das beruf betreiben.Und dann gibt's aber auch wissenschaftliche expeditionen wenn sie in den heißen wüsten sind es vielprofis die sich darauf spezialisieren aber wenn sie in die antarktis gehen dann brauchen sie natürlich eine ganz andere logistik und da gibt es ans mit auf der amerikanischen seite es gibt aber auch die japaner und die europäerdie expeditionen machen und ganz gezielt meteoriten suchen gehen.Hauptsächlich auf den sogenannten blue days fehlt also auf eis feldern wo das eis a kumuliert und an der oberfläche.Wird weil dann das eis eben die meteoriten sozusagen konzentriert das eis wird zusammen geschoben an unter dem eis befindlichen.Und wird dadurch nach oben gedrückt der wind ab plakatiert ist und.
Tim Pritlove 0:20:48
Das einfach glatt machen.
Susanne Schwenzer 0:20:50
Trägt das eis ab und die steine trägt er aber nicht ab das heißt mit der zeit geht eis verloren und steine sammeln sich an der oberfläche an und da ist dann halt sind dann halt auch sehr viele meteoriten dabei.
Tim Pritlove 0:21:05
Interessant das heißt es gibt immer mehr zu untersuchen und das heute liegt eigentlich überall rum man muss nur.

Susanne Schwenzer 0:21:12
Es gibt immer mehr zu untersuchen aber man muss natürlich gucken dass man hauptsächlich die dass mandie richtigen steine findet also ich würde jetzt nicht einfach ins internet gehen wollen und einen kaufen wo maus drauf steht denn in dem moment wo was kommerziell gemacht wird muss man halt auch äh sehr aufpassen da gibt's dann halt auch immer schwarze schafe die anzahl der e-mails die ichbekomme wo man sagt sie haben also den größten maß meteoriten den ziel gegeben hat und ich gucke da drauf und denkt naja wenn das überhauptnatürliches stücke stein ist dass du da fotografiert hast dann ist das dann wäre es ja schon mal ein anfang das ist halt extrem auch überall wo geld zu machen ist das das wissen wir ja.Nur wenn man also gesichertes material haben möchte dann wendet man sich am besten an museen ins und sammlungen.Denn wenn sie jetzt in stein finden und sagen ist das ein meteorit und dann können sie zu universitätsstadt sammlungen zu museen gehen und die leute würden ihnen das zertifizieren gegen den preis daszehn prozent des materials oder wenn es ein sehr großer ist zehn gramm des materials in dieser sammlung verbleiben.Und dieses material steht dann eben für die wissenschaft zur verfügung.
Tim Pritlove 0:22:20
Und mit dem rest.
Susanne Schwenzer 0:22:22
Mit den rest können sie sich auf den kaminsims stellen wenn sie wollen oder sie können in der wissenschaft spenden das kommt halt dann drauf an oder weiterverkaufen es gibt halt auch durchaus märkte wenn sie so ein zertifikat haben äh gibt es auchbörsen und markte wo man eben solche dinge in etwas gesicherten im rahmen kaufen kann und wo man eben die zertifikate auch entsprechend dann vorliegt.
Tim Pritlove 0:22:43
Es gibt meteoriten börsen.
Susanne Schwenzer 0:22:45
Mineralien börsen wo auch mit theoretiker.
Tim Pritlove 0:22:48
Okay.Das war ein ganz interessantes berufsfeld auf das feld bisher noch nicht so richtig gekommen jetzt habe ich den eingangs schon gesagt wir sind jetzt hier in england in milden kings einer open inversion city wie hat sich denn da hin verschlagen.

Susanne Schwenzer 0:23:04
Über die abgase ich hab ich bin dann äh nach meiner mainzer zeit erstmal nach justin gegangen und habe,mit integration beschäftigt und in der wissenschaft geht man erstmal durch eine phase wo man auf projekten ist die immer so zwei oder drei jahre lang sind das heißtman ein bisschen durch die welt leer und wander jahre wie man es auch nennen könnte und als ich mein projektin den usa ist beendet hatte das kramp war so ungefähr ein halbes jahr vorher habe ich eine stelle hier gesehen die sich mit edel gassen in terroristischen steinen beschäftigt also gar nicht mehr mal aus fand das aber sehr interessant weil es da auch wieder um diesepfade und wege ging die edel gase nehmen können sie sagten ganz richtig edel gase reagieren nicht aber sie.Reflektieren die physikalischen bedingungenwenn sich mineralöle bilden oder um bilden sie reflektieren die physikalischen bedingungen wenn wasser mit gestein in verbindung kommt und man kann dann sagen kommt das wasser von oben ist es also regenwasser oder ist das wasser das von unten aus dem erdmann kommt und diese dinge und da war eine sehr interessante stelle hier und da bin ich hierher gekommen und habe erstmal ein paar jahre erde gemachtund stand bin ich zu maß zurückgekommen.
Tim Pritlove 0:24:16
Vielleicht nochmal ein paar worte mal zur open university verlieren.Es handelt sich um eine der größten oder die größte universität in.

Susanne Schwenzer 0:24:24
Wir sind die größte universität in großbritannien wir haben aber keinen einzigen und studenten hier auf unserem campus weil wir nämlich eine fern- uni sind die deutschen sind ja mit der ferne haagen bestens vertraut wir haben dasselbe.Das heißt unsere studenten studieren von zu hause und wir liefern die materialien durch bücher.Internet wir haben ganz ganz viel jetzt auf dem internet in form von internetseiten wo dann videosinteraktive dinge alles was man technisch mit dem internet machen kann machen wir wir haben aber auch das sogenannte open,wo wir.Richtige gerät also wissenschaftliche geräte die hardware wie man so schön eng im englischen sagt haben die dann durch internetseiten bedient werden kann das heißt sie buchen sich zeit zum beispiel auf einem teleskop in teneriffa da steht das teleskop das äh könnt da können sie auch drin rumlaufen wenn sie in teneriffa sind aberwenn sie ein student der open air university sind im gastronomie dann können sie sich dort eine stunde buchen und dann bedienen sie dieses teleskop.Ob sie ein wissenschaftler wären der eben einen bestimmten stern untersucht und machen ihre hausaufgabe mit einem echten teleskop von ihrem sofa zu hause auswir simulieren auch maß missionen da haben wir eine.Ein kleines eine hütte sag ich mal äh sechs mal vor zehn meter mit sieben tonnen sand und mal halben tonnen gestein und einem selbstgebauten rover wo wir über eine woche lang mit unseren masters studenten in mission simulieren also wir nutzen die gesamte bandbreite dessen was man machen kann im bezug aufinternet interaktiv medien video audio alles.
Tim Pritlove 0:26:09
Trotzdem ist das ja hier ein riesen campus also stellt sich jetzt vielleicht vorher zehn ja so zwei drei baracken und eine gute internetleitung und das war dann die ganze universität dem ist ja mitnichten so also hier ist ja viel vor ort.
Susanne Schwenzer 0:26:20
Viel vor ort.Zum einen brauchen sie natürlich sehr viel mehr leute wenn sie eine video sache an die stunde für die studenten vorbereiten dann brauchen sie ins studio dann brauchen sie die leute die sich mit all der tontechnik und der film technik auskennen sieben sieben sie brauchen also.Mehr leute als man an einem konventionellen uni braucht wo man mit dem mit der kreide oder heutzutage dem stift für die weiße wand äh als professor oder lecture einfach da rein marschiert ist wir haben alsosoftware ingenieure und so weiter und so fort hier auf dem campus das ist die eine seite die andere seite ist wir sind auch ein forschungs- institut wir haben sehr viele laboratorien hier wir haben um zum thema mars zurück,kommen wir hatten die rein räume hier in denen die massen spektrum meter und generell bibel zwei gebaut worden ist.
Tim Pritlove 0:27:11
Also die der länder des,leider nicht ganz geschafft hat also er hat schon bis auf die oberfläche geschafft aber dann.
Susanne Schwenzer 0:27:19
Er hat es bis auf die maus oberfläche geschafft wir haben ihn vor zwei oder drei jahren haben wir gesehen in den highlights images,und die vermutung von dem was was man heute noch sieht,ist natürlich alles ein bisschen staubig geworden und sieht nicht mehr man sieht nicht mehr so die details aber das was man heute noch sieht ähm vermuten diejenigen die sich da besser auskennen als,dass er sich nicht ganz auf gefaltet hat und weil die antenne unter den solar panels war deshalb wahrscheinlich nicht genug ja.Die verbindung nicht erstellen konnte.

Tim Pritlove 0:27:50
Ja aber aus solchen gescheiterten mission lernt man ja auch eine ganze menge für.Die nächsten dann nochmal kurz bei der university ichfind das eigentlich ganz interessant ist das konzept der fern uni ist hatte glaube ich früher so ein bisschen mehr so diesen ruf mit naja dann da kommt dann irgendwie die hin die woanders nicht genommen worden sind und dann ist das so eigentlich so ein halbes studium aber ich muss sagenheutzutage mit den möglichkeiten.Die das netz so bietet scheint mir das fast das zukunft gewandt eure universität konzept zu sein wenn man irgendwie nicht so viel zeit darauf verwendetja kurz gesagt immer wieder dasselbe zu erzählen.Für jedes neue semester sondern sich sehr viel mehr daraufkonzentriert so den dieses konzept ist das flip zu implementieren sozusagen die den tisch umzudrehen zu sagen da alles was so repetitiv es lernen ist das nennt man halt einmal auf und dann,ist es quasi basis lernmaterial man konzentriert sich dann hier vor ort sehr viel mehr um die weiterbildung des nächsten schritt der studenten plus eben hier auch der forschung.

Susanne Schwenzer 0:28:56
Ja man also da sind jetzt ganz viele themen in einem satz denn zum einen wir sind die open air university weil sie bei uns keinerlei eingangs qualifikation brauchen.Da kommt das wird open air denn ganz wir sind ganz fest davon überzeugt dass ihre.Ihre möglichkeiten im zarten alter von siebzehn oder achtzehn wenn man abitur macht nicht unbedingt dementsprechen was sie als mensch leisten können.Es gibt so viele dinge die passieren in der pubertät die passieren weil die eltern gerade ihren job verloren haben man ist von so vielen dingenabhängig gerade in dem frühen stadium wenn man in die schule geht dass es reicht vollkommen dass irgendjemand meint,bulling betreiben zu müssen oder so und dann gehen die noten in keller und dann kriegt man eben kein abitur.Aber das bedeutet ja nicht dass dieser mensch nicht das potenzial hat zu lernen oder er hat vielleichtkeine lust im alter von siebzehn und sieht die notwendigkeit nicht oder was,mal passiert und wenn man das mal beiseite lässtund dann sieht dass jemand sagen wir mal mitte zwanzig oder eben mitte dreißig oder sogar noch später feststellt.Ich bräuchte jetzt diesen abschluss um weiterzukommen ich würde jetzt gerne,diesen beruf ergreifen ich habe jetzt dort sagen wir mal auf der zweiten ebene gearbeitet aber ich könnte eigentlich eine ebene höher arbeiten und hätte alle die dinge aber ich bräuchte den abschluss die leute kommen dann zu uns.Oder leute die einen beruf ergriffen haben von dem sie im zarten alter von zwanzig dachten das ist das was sie für ihr leben machen wollen und jetzt sehen mit zunehmender lebenserfahrung was sonst noch alles gibt und.Ihren beruf wechseln wollen die kommen zu uns und das sind die besten studenten die sich so vorstellen können das sind leute die sind hoch motiviert die wissen ganz genau was sie wollen.Und die studieren mit einem ganz fest.Ziel und ich muss sagen es macht unheimlich viel spaß.Ich würde es nicht unbedingt als ersatz für die universität im alter von achtzehn neunzehn empfehlen.Denn wenn man sehr jung ist wenn ich von mir selbst ausgehe im zarten alter von neunzehn dann hat man noch nicht diesesziel oder einige viele haben noch nicht dieses ziel diesediese strebst dieses ziel bewusst sein dass man so braucht und von daher ist es für mich eigentlich faszinierend zu sehen was der unterschied ist zwischen dem was wir hier eine.University also eine universität wo sie ins gebäude reingehen und im gebäude mit dem lecture vorne lernensehr strukturiert sehr auch zeitlich strukturiert weil die die veranstaltung findet eben um zehn uhr morgens statt am montag und das ist wenn sie das ist dieeben mathematik machenim vergleich zu berufsbegleitende studium wie wir es machen für leute die entweder ein beruf haben oder äh familiäre verpflichtungen die sich ihre zeit selbst einteilen dass das ist was ganz anderes und ich denke maldas sollte parallel existieren weil es ist nicht austauschbar auf der anderen seite wenn sie sagen dass repetitiv lernen wir haben tutoren unseregruppen sind sagen wir mal geologie studiert zurzeit ungefähr zweihundert leute mit uns im zwei,ja das ist also drittes viertes semesterund ähm dass diese zweihundert leute sind in gruppen zu zwanzig aufgeteilt und haben ihren toter und der total ist für die da mit dem reden die regelmäßig aber eben nicht regelmäßig um montags früh um zehn sondern äh meistens abends.Und am wochenende und dann aber auch über äh medien wo man es nicht unbedingt zeitgleich machen muss also e-mail.Video nachrichten und solche sachen.Wir nehmen auch alles auf was wir machen also wenn ich jetzt 'ne live-sendung sozusagen mache mit den studenten für eine stunde irgendwo an einem samstagabend oder was das wirdimmer aufgenommen das können sie sich immer auch noch später anhören da gibt's immer noch später die möglichkeit fragen zu stellen.
Tim Pritlove 0:33:09
Ja das hat ja auch so ein paar inklusive aspekte also was was ich allein erziehende,et cetera also einfach leute die vielleicht so im normalen universität betrieb so gar nicht folgen könnten,oder zumindest nur unter größeren anstrengungen oder einschränkungen in ihrem leben haben natürlich von so einem konzept auch etwas.
Susanne Schwenzer 0:33:26
Ja und das ist auch warum ich so gerne hier bin weil ich denke der zweite bildungsweg ist genauso wichtig wie der erste bildungsweg.
Tim Pritlove 0:33:33
So das heißt diese diese größe macht sich hier an der zahl der studenten fest.
Susanne Schwenzer 0:33:40
Und hier auf dem campus haben wir also gar keine der derjenigen die noch vor dem diplom oder master stehen wen wir hier auf dem campus haben sind die doktoranden denn wir sind ein forschungs- institut wir haben sehr sehr viele labore ähmwir haben sabor instrumentegebaut werden die dann irgendwas in der weltraum forschung zu tun haben und auch andere planeten kometen satelliten und so weiter bestücken aber wir haben auch forschungslabor der geo wissenschaften und weiter heraus aus meinem fachbereich,ingenieure und alles was man sich eben an der universität so vorstellt.
Tim Pritlove 0:34:16
Also hier wird auch viel raumfahrt gebaut viele instrumente gebaut und von daher ist das eigentlich auch ein vitaler raumfahrt standort kann man sagen.
Susanne Schwenzer 0:34:26
Sozusagen ja ich hab's zwar so noch nicht gesehen aber es ist auch nicht falsch.
Tim Pritlove 0:34:33
Ja dann kommen wir doch mal wieder ein bisschen zurück zum zum maß und der explotion also.Lange zurück ist aber schon gehört prinzip mal so ein bisschen die geschichte aufrollt der underground explotion.Darum geht es uns ja hier im wesentlichen muss man den siebziger jahren anfangen mit dieser walking mission.
Susanne Schwenzer 0:34:52
Die mission haben wir ja schon erwähnt mit den maß meteoriten in zusammenhang walking war eine,sehr ambitionierte mission karl sagenist ja der große name und für mich auch einer der helden weil er nicht nur eine tolle mission da aufgestellt hat sondern weil er auch der erste wardem ist wichtig war dass nicht nur im elfenbein turm zu machen sondern rauszugehen und den leuten zu erzählen was eigentlich passiert und warum das so faszinierend ist,keine dummen fragen kommt eigentlich von ihm und das finde ich also total wichtig auch.
Tim Pritlove 0:35:30
Muss man sagen ist auch ein großer wissenschaftskommunikation tor geworden nicht nur wissenschaftlercosmos diese fernsehserie die er da produziert hat finde ich es immer noch einer der großartigsten einführung zum verständnis des universums.Sehr interessant und ich glaube auch der begriff dieses paypal blut dort zu dieser unbedeutende kleine blaue punkt wenn man mal,mit einer was war das von der mission aufgenommen das foto quasi von der erde wo aber eben wirklich nicht sehr viel mehr übrig ist als der kleineblaue punkt das war dann auch eine interessante philosophische betrachtung um sich mal selber darüber klar zu werden wo wir eigentlich sind und welche rolle wir so im universum spielen.
Susanne Schwenzer 0:36:12
Ja er ist regelmäßig wenn man so die frage gestellt kriegt wenn du drei leute zum dinner einladen könntest tot oder lebendig wäre wäre dass er ist immer der erste auf meiner liste.Eine der sachen ja ich hätte ihn gerne kennengelernt.
Tim Pritlove 0:36:24
Okay aber er hat dann sozusagen erheblich an dieser mission mitgearbeitet.
Susanne Schwenzer 0:36:28
Ja und walking war halt eine astro biologie mission bevor das wort astro biologie so in dem sinne ähm.Gegründet war sozusagendie hatten eben instrumente mit denen sie die biologie chemie untersuchung können aber sie hatten halt auch instrumente mit denen sie nachweisen versuchen wollte.Leben auf dem mars gibt das problem der walking mission war dass man noch so wenig wusste über den mars.Deshalb viele der ergebnisse eben nicht interpretiert werden konnten oder nicht eindeutig interpretiert werden kann.
Tim Pritlove 0:37:10
Es gab zwei sondern bikini eins ist fünfundsiebzig.Gestartet sechsundsiebzig dort.In der lander das waren übernommen arbeit oder war das auch ein landesweiten landtag genau und,ja dann ging zwei kurz danach gestartet und es war sozusagen ja nicht nur die erste wirklich richtige mission zum maßnahmen eben auch gleich erfolgreich.Die wenn man sich die geschichte der maß mission anschaut die russen leider immer extrem betroffen von den felix sind amerikaner ist erstaunlich viel gelungen muss man sagen.Damit ging es im prinzip los das heißt vor den siebziger jahren muss man eigentlich herzlich wenig und durch die walking mission was wusste man dann.

Susanne Schwenzer 0:37:58
Man musste danndie zusammensetzung man wusste auch dass man man hatte die ersten bilder tatsächlich von der oberfläche denn wenn man noch ein paar schritte zurückgeht und sieht mit den fingern mit den marina missionen,dann hat man halt die auflösung aus dem orbit da sieht man gerade mal ein paar krater mit der zunehmenden aus auflösung den jüngeren marina missionen hat man dann auch gesehen dass es eben fluss bette gibtund so aber erst nachdem man wirklich auf der oberfläche war konnte man halt sehenwie sieht 's dort aus mit mit der auflösung mit der man auch hier auf der erde ein bild machen könntesehen was die umweltbedingungen sind man hat auch ähm ganz wichtig die atmosphäre gemessen und erforscht.Denn nur dadurch dass man eben die maus atmosphäre ihr die zusammensetzung windgeschwindigkeiten und alle diese dinge die für uns so mit dem,und wetterdienst so selbstverständlich sind,erforscht hat konnte man kann man natürlich auch die umwelt einschätzen mit der man es doch zu tun hat und eben die georg chemie und dann äh die ähm.Die experimente die eben sich mit dem leben beschäftigt haben wo man in in einer serie von drei in verschiedenen versuchen versucht hat herauszufinden ob irgendetwasreagiert und die,die nährstoffe die man anbietet verdaut.Heutzutage ist wohl die allgemeine meinung,dass die partei rate waren also in organische substanzenzu der reaktion beigetragen hat die man gemessen hat aber,sicher kann man natürlich nicht sein aber von dem stand den wir heute haben auch mit,phoenix lander mischen die auch wieder die park gefunden hat hat park gefunden ist wohl dass das was die reaktion ausgelöst hat,die die nährstoffe die die dort in diesem in diesem projekt zu uns gefäße drin waren,eben mit den reagiert hat und die so tope freigesetzt hat die dann gemessen worden sind.
Tim Pritlove 0:40:06
Also walking hat sozusagen die basis gelegt und man hatte jetzt das erste mal eine konkrete vorstellung,davon womit man es eigentlich zu tun hat.Und das hat ja dann im prinzip auchdiese ja diese lange liste mittlerweile von boden missionen ausgelöst oder dann sozusagen begründetdie ja dann vor allem von den amerikanern halt extrem erfolgreich durchgeführt worden und die passende mission war dann im prinzip schon die nächste.
Susanne Schwenzer 0:40:38
War der erste robert.Und das war im grunde genommen eine technologie demonstration denn wenn man raumfahrt betreibt und das beste beispiel dafür ist immer apollo dann möchte man jeden schritt einzeln erstmal üben und sehen dass es auch.Und man möchtefünfzehn schritte gleichzeitig machen und die apollo mission wenn man dadurch geht äh und sieht in wie systematisch die jeden weiteren schritt geübt haben in der apollo mission und dann gesehen habenwas die ergebnisse sind bevor sie den nächsten schritt gemacht haben zeigt eigentlich wie es am,geht und die amerikaner haben das für die lande mission genauso gemacht den ersten rover party-freundeim grunde genommen die technologie demonstration aber er hatte das instrument und natürlich kameras.Kameras sind auch immer für den geologie wissenschaftliche daten mit denen man dann eben mehr und auch von einer anderen stelle vom aus gelernt hat.
Tim Pritlove 0:41:38
Waswas hat dann die passende mission herausgefunden also war dann die instrumente so sehr waren jetzt sehr viel andere instrumente noch mit an bord oder ist es im wesentlichen eigentlich die möglichkeit sich auf dem mars bewegenkönnen und an verschiedenen stellen proben zu nehmen oder urlaub sehr baff also.

Susanne Schwenzer 0:41:59
In der europa war im hauptsächlich eben die technologie demonstration der lander hatte einige instrumente ich meine sie fliegen nicht zum mars ohne eine wetterstationen mitzunehmen zum beispiel aber das wichtige dass was für die weiterentwicklungder maß missionen wichtig war war dass man eben den kleinen rover hatte,dass der auch ein instrument drauf hatte dass dass man gelernt hat wie man sich in dem.Bewegen kann dass man gesehen hat dass es eben geht und die ingenieure seite ist ja immer das wichtigste denn wenn sie kein instrument haben dass sich bewegt.Dass die dinge durchführen kann die sie durchführen wollen dann brauchen sie mit der wissenschaft nicht anzufangen da haben sie nämlich keine da.Das heißt.Wissenschaftlich vielleicht die wichtigste erkenntnis war dass der staub der auf maß in durch die atmosphäre regelmäßig immer wieder verteilt wird,überall allgegenwärtig ist und dass viele der messungen die vom instrument auf,gemacht worden sind eine starke komponente von diesem staubmit drauf hatten und das ist halt auch ein grund warumdie nachfolgenden missionen eigentlich alle irgendwas haben womit sie den staub von der oberfläche entfernen können.Das tool oder die brush je nachdem welche mission sie jetzt neben rock tool wäre das instrument,die maß experience over spirit and opportunity haben auf dem robert robert,es eine meine bürste.
Tim Pritlove 0:43:41
Immer wieder ganz einfache lösung funktioniert am besten.
Susanne Schwenzer 0:43:44
Ihr ja wenn sie sie wollen so wenig wie möglich bewegliche teile wenn sie ein instrument bauen wo sie nicht hin können und reparieren gehen können.
Tim Pritlove 0:43:54
JaAlso der der rover auf im rahmen der parfüm mission das war ja schon so prinzip.So sechs räder apparat bestand im wesentlichen so oben aus einer großen aus dem großen solar panel wo dann die ganzen instrumente darunter waren,der konnte also im wesentlichen erstmal rumfahren.

Susanne Schwenzer 0:44:19
Der konto rumfahren und er konnte wie gesagt die steinchen nehmen das war das wichtigste und wenn sie sich das.Von einem test standpunkt aus anguckenin dem moment wo sie wissenschaftler und ingenieure zusammenarbeiten lassen wissenschaftler haben bestimmte ziele die von dem.Bestimmt sind was wir sehen.Wenn wir steine sehen die überall vorkommen dann wollen wir natürlich wissen welche zusammensetzung die haben aber dann ist plötzlich einer der sieht anders aus dann wollen wir natürlich wissen wie der sich auch chemisch unterscheidet das heißtuns interessiert nicht so sehrdie frage ist der pfad den wir da hinfahren wollen der sicherst mögliche den wir jetzt fahren können sondern wir denken nach gewissen zieleningenieure natürlich schauen und auch zu vollkommen zu recht sehr viel mehr nach sicherheit nach der befahrbar kalt eines unter grundes und solchen dingen und dieses zusammenspiel muss man auch erstmal lernen.Wie viel kann ich als wissenschaftler erwarten von so einem instrument wieviel können die ingenieure das was sie eigentlich als grenzen gesetzt haben so ein bisschen ausweiten wie sicher werden die sich mit der zeit eine mission mit diesen dingen das sind halt fragen die im laufe der zeit.Wickelt werden und wo es wichtig ist dass auch erfahrung gesammelt wird.Und das kann man natürlich zum teil hier auf der erde machen mit mission simulationen wo man das kann man zum teil auch insbesondere wenn es um die ingenieur fragen geht in sogenannten maus ja zu machen wo man also bedingungen simulieren kann und dann ähein equity valentin instrument natürlich sehr viel herrscherin tests aussetzen kann als dass sie dasje auf einem anderen planeten machen würden da gibt's also viele viele möglichkeiten am dieses zusammenspiel ist das erste mal mit dem trainer gemacht worden.
Tim Pritlove 0:46:13
Und was war so die großen errungenschaften immer das war ja noch zu einer zeit als sie nicht unmittelbar selber mit den projekten beschäftigt waren sondern das quasi noch so parallel liefert hat man da so mitbekommen was waren so die.Die weiteren erkenntnisse die jetzt aus dem aus dieser mission hervor kam.
Susanne Schwenzer 0:46:30
Für mich war es wirklich die gestalt zusammensetzung ich hab damals dann sehr bald auch angefangen mich mit den mars meteoriten zu beschäftigen und die gestein zusammensetzendie georg chemie das war für mich persönlich die große,von dem europa und,aber auch das instrument ist am max bank institut gebaut wordenund auf eine ganz persönliche ebene zum ersten mal hautnah mitzubekommen weil ich eben kollegen hatte mit denen ich im büro geteilt habe und die dann auch,gearbeitet haben wie so was abläuft die begeisterung zu sehen zu zu fühlen wie sich das anfühlt wenn man ein bild.Allerersten mal hier auf der erde sieht und man einer von zehn leuten ist sie das jetzt gerade zum,mal sehen das ist eigentlich etwas dass man.So nur mit der expo ration neuer kontinente oder vielleicht heutzutage der mit oder sowas untersee,petitionen vergleichen kann.
Tim Pritlove 0:47:32
Aber man hat mal ist ja auch nicht mehr ganz ergebnisoffen also man will ja sozusagen hin auch um und er hat ja auch bestimmte dinge die man überprüfen möchte so also was war sozusagen dasprimäre ziel klar also die grundsätzliche grundsätzliche zusammensetzung von allem um überhaupt erstmal zu,und auch um dann eben solche maß methodeeinordnen zu können und man beweisen zu können dass es halt auch wirklich welche sind aber was ja immer eine große rolle gespielt hat war also die frage die suche nach dem.Wasser auf dem planeten.

Susanne Schwenzer 0:48:03
Und das kommt daher dass eine der fundamentalen fragen eben die frage ist sind wir alleine oder gibt es noch irgendwo anders als auf der erde leben und um nach sowas zu suchen muss man sich natürlich,mal einen anfang setzen und da war der anfang den die nasa sich gesetzt hat follower water,folge dem wasser weil wir wissen von leben auf der erde das wasser absolut notwendig ist wenn sie in die.Wüsten hier auf der erde gehen dann gibt,ganz ganz wenig nur an pflanzen und tieren das dort existieren kann und die haben strategien wie sie wasser speichern wie wasser freie zeiten überstehen wenn man das jetzt auf den maus überträgt wo man eben nicht wusste oder nur von den,von dem was man wusste gibt's gar kein wasser wir wissen heute dass es teilweise regionen gibt wo es ein kleines bisschen oberflächen wasser auch heute noch geben könnte in.Zeiten die so genannten recruiting sloppy aber das wusste man damals alles ja noch nicht das heißt die frage war hat es jemalsfließendes wasser auf der maß oberfläche gegeben oder,ist es nur in der im untergrund des maß oder vielleicht überhauptnicht wirklich so wie auf dem mond also das sind alles fragen,man sich von anfang an gestellt hat die eben schonbei marina eigentlich bei den satelliten missionenwichtig waren und dann mit dem mit allen missionen die äh auf dem mars landen auch immer wichtiger geworden sinddie fragen werden komplexer jeder je näher wir uns dagegen wart nähern denn leben ist ja nicht nur von wasser abhängig sie brauchen auch organische materialien sie brauchen auch an die chemie im ganzen ähm,jeder weiß es essentielle elemente in körper braucht kalzium im körper braucht magnesium bakterien genauso und sind diese dinge alle vorhanden jeder hat schon mal gehört dass es elemente gibtich sage nur mal aussehen aber auch zum beispiel kupfer die als antjebiotec wirken können die lebens feindliche sind man muss die gesamt zusammen den gesamt zusammenhang verstehen ganz am anfang war es aber das wasser.Und die frage können wir nachweisen dass es dort jemals wasser gegeben hat denn wenn sie eine mission schicken wollen die tatsächlich nach leben sucht oder nach spuren vergangenen lebens sucht.Wenn sie wissen dass dort nie wasser war braucht man im prinzip erstmal nicht anzufangen zu suchendenn sie müssen es irgendwie eingrenzen und deshalb grenzt man es erstmal ein auf leben wie wir es kennenund von dort dann sucht man nach bedingungen wo es vorgefallen bekommen hätte sein können um dann missionen zu schickenwie jetzt zum beispiel die thomas mission die nächstes jahr fliegen wird und bohren wird.Um nach den sogenannten biomarkt also nach spuren vergangenen lebens zu suchen.
Tim Pritlove 0:51:03
Und hat schon an hinweise liefern können für die frage wasser.
Susanne Schwenzer 0:51:12
Ichich bin mir so nicht ganz sicher im moment wenn ich ehrlich bin denn die der wirkliche,durchbruch der sich mir als außenstehender.So eingeprägt hat sind die blueberry s und sind die sachen die die maße explosion robers gefunden haben.Da darf hat das für mich wirklich angefangen zu sagen ihr habt das ist wie auf der erde und ja wir haben hydro tamal systeme wir haben wasser gestein wechselwirkung wir haben situation die mit von wasser abhängig ist und so weiter.
Tim Pritlove 0:51:42
Genau damit wären wir dann sozusagen schon bei der nächsten mission und die war ja dann auch sehr viel wie soll ich sagenmedienwirksam auf jeden fall also das äh ich erinnere mich selber noch sehr gut daran als die mission gestartet ist also maß explosionrover ist die mission ja dann gleich mit zwei rowan gestartet ist birgit und opportunity heute verhältnismäßig.Bekannt weil einfach extrem erfolgreiche missionen man dachte glaube ich oder ursprünglich mal glaube ich so davon ausgegangen naja wenn die dinger vierzehn tage lang oder oder einen monat neunundneunzig tage ok neunzig tage,schon richtig erzählt also neunzig tage halten so dann ist das ziel irgendwie erreicht aber am ende waren's.Dreizehn nein sechzehn jahre.
Susanne Schwenzer 0:52:35
Ja der spirit etwas kürzer alsgenaue zahlen kann ich ihnen nicht sagen aber äh was ich ganz gerne sage wenn ich vorträge halte ähm wenn neunzig tage war die garantie zeitund spätestens als zehn jahre erreicht waren kann man dann sagen wenn alle unsere autos so lange halten würden wären wir alle mit einer lissy unterwegs.
Tim Pritlove 0:53:00
Ja also das ist äh genau also spirit hat bis bis zweitausendelf.Gehalten das ist natürlich irgendwie wirklich irre.
Susanne Schwenzer 0:53:09
Und opportunity bis letztes jahr glaube.Letztes jahr war der große sand sturm war.
Tim Pritlove 0:53:16
Also was was war jetzt so sein die bis also wie wie inwiefern waren denn jetzt diese mission besser ausgestattet oder anders ausgestattet als,der vorgänger.

Susanne Schwenzer 0:53:25
Die missionen waren wissenschafts mission und nicht ingenieur missionen natürlich hatwie der name der gesamte mission paar feinde auch sagt den weg bereitet aber die mission war insofern anders als dass sie keine ingenieur mission von der nase initiiert war sondern wir hatten einen sogenannten prinzip investigative,professor steve von der seine mission beantragt und gebaut hatum das thema follower water wir wollen sehen was die georg chemie ist war wasser.Mitbeteiligt und hat eben mit den kameras mit den spektral kameras aber auch wieder dem instrument 'ne ganze reihe instrumente gehabt die.Die chemie und die gesamtheit der der landschaft eben untersuchung konnten und,hatten eben sehr viel glück dass europa auch so extrem lange gehalten haben.Und haben dann sowohl vom spirit als auch vom opportunitydiverse gestein formationen diverse chemie gefunden die ganz,eindeutig dafür spricht dass eben was er gestein wechselwirkung stattgefunden haben das heißtdiese mission sind für mich persönlich diejenigen die mir zum ersten mal klar gemacht haben wie.Wie viele gemeinsamkeiten es gibt zwischen mars und der erde undwie übertragbar aber dann auch wieder nicht übertragbar unsere erkenntnisse die wir hier auf der erde sammeln über das leben auf der erde auf den mars wären.Und übertragbar sind sie was die steine angeht wir haben bei salzige steine maß hat ein bisschen mehr eisen das habe ich vorhinim zusammenhang mit dem meteoriten schon mal gesagt aber im.Es sind nach wie vor bei salzige steine sie haben eisen zwei plus das dann o x ignoriert werden kann und alsund äh alle situationen und reduktion prozesse sind immer vorteilhaft fürleben wenn man jetzt auf das thema zurückkommt und eröffnen da möglichkeiten wir haben also wasser wir haben in redoxpotential wir haben etwas voss vor was man ja auch braucht calcium magnesium und so weiter und so fort diese parallelenaber dann auch wieder ganz krasse unterschiede unsere erdatmosphäre hat sauerstoff die maß atmosphäre hat praktisch keinen sauerstoff wir haben eine.Stickstoff atmosphäre mars hat eine c c o zwei atmosphäre also es gibt dann auch wieder unterschiede mit denen man rechnen muss und die man dann wiederum nur im labor simulieren kann weil eben die erde dann doch wieder anders ist und,diese gemeinsamkeiten und unterschiede das ist wirklich das was die,spirit und opportunity mission für mich ganz persönlich herausgearbeitet haben.
Tim Pritlove 0:56:24
Was ich nicht verstanden habe wie hat man das wasser gefunden ohne das wasser zu finden also man hat sich sie gestein angeschaut und was dann daran entdeckt.
Susanne Schwenzer 0:56:33
Da kommen wir jetzt wieder zur mineral energie zurück denn im insofern als das.Gewisse mineralöle entstehen wenn wasser und gestein miteinander in verbindung kommen fangen wir mal.
Tim Pritlove 0:56:49
Zum beispiel.
Susanne Schwenzer 0:56:52
Fangen wir mal mit einem ganz einfachen beispiel an salz sehen wenn sie wenn sie wasser haben und das immer weiter ein dampfen entstehen ganz bestimmteab folgen da kriegen sie erst lori de und dann promis spirit hat ich glaube es war im viktoria krater ein profil gemessen wo man diese abfolge gesehen hat.Und äh gerade promille und gloria rede können sie.Allerbesten durch ein dampfen des wasser sie voneinander separieren das heißt hier haben sie diese diese typische abfolge wo man eine parallele herstellen kann man kann aber auch andere mineralöle angucken.
Tim Pritlove 0:57:31
Gibt's gibt's nicht eine andere erklärung mit dir das hätte auch passieren können oder ist das schon so ein ist das schon so so eine heiße.

Susanne Schwenzer 0:57:37
Das ist eine sehr sehr heiße spur das ist eine sehr sehr heiße spur die.Im prinzip anders nicht zu erklären ist andere heiße spuren sind mineral die wasser in ihrer struktur eingebaut haben nehmen sie ton mineralöle.Die haben wasser als eine oha gruppe in ihrer struktur eingebaut.Sie können sie nicht machen wenn sie kein wasser haben denn sie können noch was einbauen was sie auch haben und ist diese gruppen die kann man halt.Sehr gut auch sehen das heißt nicht nur dort wo man gerade eben steht mit seinem rover sondern auch in der weiteren umgebung oder sogar von satelliten aus beobachten.Und dann sehen sie ton mineralöle sie sehen aber auch soll fahrte auch wieder eine mineral gruppe die immer nur in zusammenhang mit wasser entsteht und dann auch wiederum wasser einbaut in die struktur das heißt,von dem was wir über mineral entstehung wissen.Sind mineralöle dort zu finden die sich ausschließlich in wasser gestein wechselwirkung oder durch eine lösung von wasser bilden können.Und das ist im prinzip denn an einer der nachweise dass wir wasser auf der maß oberfläche hatten.
Tim Pritlove 0:58:51
Das heißt man hat das wasser erstmal nicht selber gefunden man hat aber eindeutige spuren gefunden dass es mal da gewesen sein muss weil sonst eben bestimmte mineralöle so nicht hätten existieren können.

Susanne Schwenzer 0:59:03
Und das ist natürlich auch ganz wichtig die satelliten hier ins spiel zu bringen denn die geomantie logi e äh also die betrachtung der oberfläche eines planeten,mindestens genauso wichtig denn wenn sie von der auf einem planeten oberfläche schauen dann sehen sie zum beispiel fluß täler.Mit der ganz typischen meer frierende oderzeigten moralphilosophie und das kennen sie von der erde die bedingungen wann die mehr integrieren und wann die sich vor zweigen und können das dann sie müssen immer für die schwerkraft.Korrigieren aber können das dann übertragen und auf die art und weise kann man also vom satelliten,beispielsweise fluß täler feststellen man kann äh erosion spuren feststellen wenn man jetzt landet.Eben sich die oberfläche von einem von einem.Form die gelandet ist anschaut rover oder lander dann kann man diese,auch sehen eine der ersten erkenntnisse von curiosity waren diese kondome rate die wir gefunden haben einfach in bildern gesehen haben und uns dann ausrechnen konnten wie ein fluss der die transportiert hat hätte aussehen müssen,man hat also die moto logi e zusammen mit der georg chemie und was ich ganz wichtig finde ist zu betonen dass niemals.Einziger hinweis alleine,der beweis ist sondern nur der zusammenhang viele verschiedene dieser indizien kann uns letzten endes bestätigen was geschehen ist oder auch nicht.
Tim Pritlove 1:00:32
Was war denn die lande orte von spirit und opportunity gut gewählt.

Susanne Schwenzer 1:00:38
Jaich denke schon es waren zwei sehr verschiedene lande orte natürlich für spirit hatte man sich erhofft dass man in einem großen see ein getrockneten seebad oder irgendwas landet und seitdem ente findet was man erstmal nicht gefunden hat aber das ist expo ration ich mein wenn man 's vorher gewusst hätte.Es war halt noch keiner da das so ist das nun mal aber es,hat halt unheimlich viele,wunderbare erkenntnisse gehabt die sind in die hass bin hills hoch geklettert und haben dort ins insbesondere um home herum.Sehr viele indizien gefunden für hypothek male,mineral also mineralöle die mit wässern die aus der mehr aus dertiefe kommen entstehen die haben die ablagerungen gefunden die haben karbonat gefunden also eine ganze weite bandbreite verschiedene indizien von verschiedenen wasser gestein wechselwirkung.Und das ist halt grade weil es auch so divers ist hoch spannend.Der opportunity der ist eben auch das ist sehr sehr weit gefahren und die letzte große erkenntnisse in marathon valley undin dem bereich war eben dass wir dort ein echtes.Impakt generiert das hydro tamara system haben also wir haben uns eingangs unterhalten wie im park krater entstehenwenn der staub sich dann gesetzt hat haben sie natürlich immer noch die ganze energie in dem untergrund drin heiße gesteinigt geschmolzene steine und dann kann sich ähnlich wie äh um volkan herumein hydro tamal system ausbilden wo heißes wasser durch,untergrund zirkulieren und mineral gestein wechselwirkung verursachtgenau das haben die halt dort auch gefunden das war so die letzte große erkenntnis von opportunity,die aber auch extrem wichtig war denn wir haben diese sachen aus dem orbit beobachtet wir satelliten haben verschiedene mineralöle gesehen aber vom von dem satelliten fehlt ihnen der direkte geologisch e zusammenhang den der feld theologe vor ortwas so ein rover letztlich ist eben herstellen kann.
Tim Pritlove 1:02:48
Ich hab grade mal so geguckt ist ja auch sehr schön man kann ja mit google oder sich auf den mars anschauen und dann auch die ganzen reise routen der rosa nachschlagen das ist ja eigentlich sehr schön,benennt eigentlich diese ganzen krater dann immer mit so hübschen namen.

Susanne Schwenzer 1:03:07
Letztlich ist es die eu die namen wirklich bestätigt es gibtzwei ebenen wenn sie anfangen irgendwo sich im gelände zu bewegen und viele leute die selben bilder ansehen dann brauchen sie einen momenttour und stein eins zwei drei funktioniert nur wenn sie nur fünf stück haben aber in den nochmal eine landschaft hat eben sehr viel mögliche ziele der untersuchung das heißt missionengeben sich regeln wie einfach.Ziele benannt werden und das kann in eine kleine sandbühne sein das kann ein einzelner stein sein das kann ein größerer,gestein zu rücken sein auf curiosity haben wir eine karte erstellt,am anfang die in quadranten unterteilt war und die quadranten haben einen namen und dieser name,von irgendwoher geografisch gesehen auf dererde zum beispiel sind wir momentan im sogenannten tori don quadrat für die curiosity mission das heißt unsere namen momentan kommen von geografischen namen aus schottlandund wir haben eine lange liste und nach der wir dann eben dinge benannt weil sie brauchen diese namen menschen sind nicht gut nennt sich lange mehr stelligen nummern zu merken.
Tim Pritlove 1:04:28
Er ist auch langweilig an vielen drückt sich ja auch eine gewisse kultur aus.Ja also eine erstaunliche strecke und man sieht halt wie sehr man dann irgendwie zielgerichtet auf insbesondere die hohen strukturen aus war oder eben auf die karte je nachdem was auf dem viral war.
Susanne Schwenzer 1:04:46
Ja und das ist der grund dafür ist dass geologie gegen sogenannte ausschüsse brauchen wenn sie über eine flache landschaft fahren dann sehen sie nicht unbedingt den untergrund.Aber wenn sie in in dieser landschaft brüche habenalso zum beispiel eine krater wand oder wenn sie hier auf der erde unterwegs,sind wir gerade eine straße neu gebaut wird dann wird dann,stehen auf schlüsse in den untergrund wo man eben nicht nur die zweidimensional ale oberflächen struktur sehen kann sonne die dritte dimension in den untergrund und so was haben sie im gebirgewo sie sehr gerechte wände haben und so was haben sie in kratzern wo eben ihnen sozusagen jemand ein loch frei kostenfrei.Gebohrt hat geschaufelt hatte wie man sagen möchte.
Tim Pritlove 1:05:34
Da selber was zu bord sieht man grade ist gar nicht so einfach äh auf dem mars die maß insights mission versucht hier gerade mit so einem kleinen hämmerchen und bora in die erde reinzukommen um dort einmal in der tiefe dinge messen zu können aber das gestaltet sich,schwierig.
Susanne Schwenzer 1:05:49
Das gestaltet sich momentan sehr schwierig und das einzige was ichzu wirklich sagen kann ist dass ich die luft anhalten und meine und die daumen.Die das schaffen denn den wärme fluss zu messen was diese sondern eigentlich vorher,wäre eine der ganz großen meilensteine in der maß forschung warum es nicht gemacht worden ist bisher sehen wir gerade es ist nämlich gar nicht so einfach.
Tim Pritlove 1:06:09
Ja da ist alles ziemlich schwierig was war denn ihre rolle bei spirit und opportunity.

Susanne Schwenzer 1:06:16
Da sozusagen also ich habe für spirit and opportunity war ich mit der mission selbst nicht beteiligt ich hab allerdings während ich in,war sehr viel von den daten verwendet und meine eigene forschung auf diesen daten.Gebaut das gute bei nasa missionen ist dass alle daten spätestens nach sechs monaten auf derplanet data system gegeben werden und sind für jeden zugänglich als einzige was sie brauchen ist eine funktionsfähige e-mail-adresse,und dann können sie sich auf dieses planeten data system einloggen und dann können sie die mission verfolgen noch in weit größeren.Teil als sie das jetzt auf google oft können und können von jedem jedem messwert der je genommen worden ist sich selbst.Eben ansehen und auch für ihre eigene forschung weiterverwenden und das hab ich halt genutzt und hab einige meiner äh wasser gestein modelledie ich als mineral loge eben mir erstellt habe die hab ich mit diesen daten gemacht und es ist eine sehr sehr schöne quelle weil die eben so lange unterwegs waren so viele verschiedene dingeuntersucht haben ist eine wunderbare quelle für geologisch daten auf maus.
Tim Pritlove 1:07:35
War das dann schon zur zeit hier auf der open society oder noch feuer.
Susanne Schwenzer 1:07:39
Das war vorher ich war zwei jahre in husten am institut da habe ich das gemacht ähm zusammen mit doktor david der hatte das projekt ein geworben und ich habe da als sogenannter post stock gearbeitet.
Tim Pritlove 1:07:51
So aber jetzt wird's ernst.Nach dem opportunity so erfolgreich waren vieles der nasa glaube ich etwas leichter gleich die nächste mission nicht nur aufzulegen sondern auch gleich so richtig super das heißt zu planen.Das maß science laboratory oder eigentlich alles bisschen besser bekannt unter dem mitnehmen des robers curiosity.Daswar dann schon ein erheblicher schritt weil man jetzt nicht so ein vergleichsweise kleinen minirock hatte der mit kleinen rädern durch die gegend rollt sondern ich glaube ich ja wenig leute klammern ist das so dieserja dieses laboratory wie's ja offiziell eigentlich heißt also dieser rover ist ja so in der größenordnung eines weiß nicht vw golf größer sogar noch.
Susanne Schwenzer 1:08:42
Nehmen wir ungefähr ja also der rover ist eine tonne schwer und der mast ist zwei meter hoch ungefähr.
Tim Pritlove 1:08:53
Tonnen schwer bei uns wenn er hier rumsteht.
Susanne Schwenzer 1:08:58
Und äh zwei meter hoch ungefähr und ist.Hat viele unterschiede aber auch wiederum viele gemeinsamkeiten zu spirit opportunity die gemeinsamkeiten ist der geologie.Denn wir haben das instrument wieder wir haben kameras wir haben kameras die spektral analyse machen.
Tim Pritlove 1:09:18
Aber nicht dasselbe instrument sondern schon eine weiterentwicklung.
Susanne Schwenzer 1:09:22
Ein neues ein neues das instrument ist an und für sich ein sehr robustes instrument das hervorragend funktioniert und ähm man ändert nur die dinge die man ändern muss entweder weil man eine weiterentwicklungbrauchtoder weil man irgendwas festgestellt hat dass nicht so funktioniert also entweder sie brauchen eine weiterentwicklung aus wissenschaftlichen gründen aber das instrument ist eines der instrumente von dem wir ganz genau wissenwie es funktioniert wie die daten zu.Sind es ist sozusagen eine konstante in den ganzen und.
Tim Pritlove 1:09:59
Das hat man ja selten in der raumfahrt.
Susanne Schwenzer 1:10:01
Das hat man selten weil ganz viel natürlich auch die weiterentwicklung dass das weitere erforschen nichtnur der wissenschaftlichen sondern auch der technologischen seite von seiten der ingenieure immer eine große rolle spielt,und auch eine berechtigte rolle spielt denn wenn wir uns weiterentwickeln wollen dann müssen wir die grenzen immer austesten und versuchen zuerweitern aber wenn man natürlich ein instrument hat dass man als konstante verwenden kann dann macht das die dinge leichter und auch effizienterund das marc ins laboratory das hat halt zum ziel gehabt auch wieder die geologie der umgebung zu untersuchenes hat zum ziel gehabt.Also die bewohnbar kalt aber wenn ich jetzt bewohnbar zeit sage dann meine ich für mikroorganismen.Nicht für komplexere organismus diese des geld grad das zu untersuchen und auch zukünftige mission vorzubereiten.
Tim Pritlove 1:11:03
Warum hat man den gel quarter als ziel genommen.

Susanne Schwenzer 1:11:07
Lande stellen werden immer in einem komplexen verfahren ausgesucht das heißt jahre bevor die mission überhaupt startetgibt es einen aufruf an die wissenschaftliche gemeinde zu sagen wir wollen einen rover landen wo sollen wir das tun und dann finden workshops statt in denen,möglichkeiten vorgestellt ausgearbeitet und dann auch wieder ausgeschlossen werden das ganze ist im letzten ende ein demokratischeran denen dann einen vorschlag meistens in einer prioritätliste von drei oder vier landes stellen an die nase weitergegeben wird.Und die nasa prüft die dann alle denn dasaller allerwichtigste ist die sicherheit des instruments wenn man nicht garantieren kann dass man irgendwo um sicher landen kann,dann braucht man gar nicht erst zu fliegen denn wenn manmichael ankommt dann war's das mit der mission von daher ist das ingenieur wesen und die betrachtung des ausgesuchten standortes halt,extrem wichtig natürlich gibt's einschränkungen schon vorher man kennt sein landeslisten man weiß auf welcher höhe man landen kann man weiß wo auf dem planeten im bezug auf ähm.Dem den breiten und lenkrad man landen kann man weiß.Geologie wo möchte man landes in dem fall waren dass die.Die sogenannten joachimwo man landen wollte man weiß wo die vorkommen da gibt es karten man weiß äh die höhe man könnte also nie auf dem olympus monz landen weil dort die luft so dünn ist dass man eben im moment mit den gängigen landes system nicht thailand kommen würde das heißt alle diese dinge werden in karten dargestellt dann bleibt ein teil des maß übrig und densich die wissenschaftliche gemeinde an und sagt dort möchten wir hin.Dann aber müssen wir auch noch gucken wie sie das gelände im einzelnen aus dann kommt das highlights instrument am auf maß express wieder zum tragen wie groß ist die raue seit der oberfläche wie viele gesteinsbrocken liegen rumkönnen wir mit dem was wir dort landen wollen an dieser stelle sicher landen und.
Tim Pritlove 1:13:14
Also highlights dieses drei erfassung also die.
Susanne Schwenzer 1:13:16
Kamera die resolution experiment also die kamera die eben sehr kleine strukturen auch erkennen kann.
Tim Pritlove 1:13:24
Durch die komposition dann eben so ein richtiges dreidimensionalen sehr feines modell der oberfläche auch erstellt werden konnte.
Susanne Schwenzer 1:13:31
Und das braucht man halt denn curiosity hatte in radar und konnte ihn immer relativ kleinen raum landen deshalb konnten wir auch neben diesem sechs kilometer hohen berg job,realismus landen also dem zentralen,im krater aber die die grundlage ist erstmal festzustellen ist es dort sicher,möchte natürlich auch nicht irgendwo in den dünen landen weil dünen sind.Ganz schwierig zum durchfahren man muss haltdass man irgendwo landet wo man sicher landen kann aber auch sicher wegkommt wenn man einen rover hat.Und das sind die ingenieure die da hervorragende arbeit leisten,bei der nasa und die die grundlage dessen bilden.
Tim Pritlove 1:14:17
Auch die abteilung muss ich sagen hat auch wirklich hervorragende arbeit geleistet also die dass das ganze getue um um diese landung dieser mission hat irgendwie alles geschlagen.Bis heute was man da so also außer etwas herausholen konnte also allein dieses seven mädels auf terror videodas ging ja irgendwie um die ganze welt und hat dann irgendwie alle auf einmal so mitfiebern lassen so mit demapparat abgesetzt wird aber hat ja dann auch alles wunderbar funktioniert was natürlich auch nochmal dazu beiträgt dass man sich das so merkt.
Susanne Schwenzer 1:14:54
Ja der mensch von dem ich den größten respekt habe ist der der die ansagen macht im control während der landung und dann mit einer völlig ruhigen stimme sagt on mars.
Tim Pritlove 1:15:04
Und da dreht durch okay aber was ist denn noch,an bord gewesen also das ist ja nun bei so einem riesigen apparat nimmt man ja nicht nur ein instrument mit was man sowieso schon paar mal dabei hatte.

Susanne Schwenzer 1:15:17
Nein ist so also wir haben das wasems unterscheidet von spirit ist das was im ober selbst sich befindet.Noch andere kleinere dinge aber hauptsächlich das was im robert selbst sich befindetund das camp instrument der große laser der auf mast sitzt die chemie das da kommt auch der name laboratory her neu ist zum beispiel das instrument das.Ein massen spektrum meter ein gast carmato grafen und ein blazer spektrum meter in einem vereint wir haben ein das bedeutet übrigens analyse sie wir haben einen ofenin denen wir eine probe einbringen können aufheizen können und die gase die dann freigesetzt werden messen können.Äh wir können das kommando grafik machen für organische moleküle wir können mit dem turnier blazerkilometer hauptsächlich mit taten messen wir haben aber auch ein massen spektrum meter mit dem wir die gase messen können unter anderemdas heißt wir haben die gesamte bandbreite dessen was gas förmlich unterwegs ist vom.Stickstoffdioxid carbon also kohlenstoff seinezwei wasser el gase metall und so weiter und so fort dass wir messen können.Und wir haben auch die möglichkeit eines sogenannten,experiments wir haben dort neunkleine reaktionsquote fässer in denen eine substanz drin ist die,derivat station organische moleküle freisetzt ohne dass man heizen muss das heißt,organische moleküle aus dem gestein in eine gastro fase umwandelt und wenn können wir die über das gas massen spektrum meterin gaskocher grafen ins massen spektrum meter einlassen und können die organischen materialien messen das ist das.Sam instrument wir haben aber auch chemie was einder fraktur meter ist mit dem wir ganz genau die mineral logi e bestimmen können auch da wird eine probe in den roberteingebracht in eine kleine zelle durch die der röntgenstrahlen dann durchgehen kann und wo wir im prinzip renten der fraktion machen können genauso wie wir es im kreis zwischen labor auch können und dann sehr genau feststellen könnenwelche mineralöle vorhanden sind und das ist der das ist der große unterschied das ist auch warum das instrument so viel größer ist ein anderes instrument was auch.Ganz ganz hervorragende ergebnisse geliefert hat undnicht auf den spirit apportieren tirol drauf war ist camp camp kamera das ist ein laser mit dem man ein gestein öffne größeren entfernung.Anschließen kann und dann entsteht ein plasma und dieses plasma kann man spektrum tropisch untersuchen und dann auch die gestein chemiefeststellen das ist sozusagen parallel zu dem was das kann das hat ein zwei komma fünf zentimeter durchmesserfußabdruck wie man es auf englisch als football bezeichnet das heißt das misst diedurchschnitts zusammen umsetzung von einem zwei komma fünf zentimeter durchmesser punkt auf der oberfläche aber sie müssen.Vor ihrem zu untersuchungen gestein davor stehen den arm aus fahren und den arm praktisch draufsetzen damit sie die untersuchung machen können das ist aufwendig das dauert.Zeit der cam laser kann in einer entfernung von bis zu sieben meter im durchschnitt nehmen wir so drei dreieinhalb meter weil das,entfernung ist wo es am besten funktioniert wie die besten daten kriegen sehr leicht ziele anvisieren.Und bekommt dann zehn kleine punkte von fünfzig mikrometer durchmesser da bekommen sie dann natürlich die variabilität des gestein aber sie bekommen auch wiederum die gestein chemie und zusammen diese beiden instrumente erlauben uns halt sehr genau die geologisch umgebung zu charakterisiert zusammen mit verschiedenen.Strahlen instrumenten die durch die kameras dazu kommen.
Tim Pritlove 1:19:41
Das instrument mit den taschen ofen wo man sozusagen die kleinen proben reintut diesen ja dann immer verbraucht ne also man hat dann sozusagen so so und so viel schuss und dann ist irgendwann weg weil man man kriegt das nicht wieder leer.
Susanne Schwenzer 1:19:54
Man kriegt es nicht wieder leer man kann aber wenn man weiß dass man eben äh hoch genug geheizt hat unter umständen die zweite probe mit in denselben ofen einbringen ähm.Kommt immer darauf an dass das in entscheidungen die man von fall zu fall treffen.
Tim Pritlove 1:20:09
Aber mit dieser camp ist im prinzip so viel durch die gegend schießen wie man möchte.
Susanne Schwenzer 1:20:14
Cam und auch die können so viel durch die gegend schießen wie sie wie sie möchten kevin kann seine zellen auslernen aber das instrument wie gesagt das haben sie geschmolzen ist gestein drin das.
Tim Pritlove 1:20:28
Das funktioniert da nicht mehr.
Susanne Schwenzer 1:20:29
Aber man kann unter umständen die zweite probe einbringen.
Tim Pritlove 1:20:32
Aber damit kommt die zumindest schon mal sehr nah so an unsere vorstellung von so sein wenn man so auf anderen planeten rumfährt und überall mit dem laser abschießt und dass man jetzt irgendwie keine gegner vernichtet sondern im prinzip ja die ganze zeit einfach überallworaus besteht denn das alles.
Susanne Schwenzer 1:20:49
Und das ist halt unheimlich wichtig denn wenn sie geologisch grundlage nicht verstehen dann können sie auch nicht verstehen wie,die umwelt aussieht wie die umwelt auf wasser kontakt reagiert und wie die bedingungen wären wenn irgendwelche bakterien oder andere mikroben dort wären.
Tim Pritlove 1:21:12
Und wie groß ist jetzt so der informationsgeber da pro meter so sind die erwartungen die ja sicherlich nicht gering waren an so eine komplexe chemische analyse auch schon erfüllt worden.

Susanne Schwenzer 1:21:24
Ja ganz eindeutig ja ich meine äh so eine mission die erwartung war im prinzip zu beweisen und zu charakterisiert was.Dieses dieses seebad dass wir dort haben eben an bedingungen,bieten würde und der krater ist halt eine depression eine vertiefung in der sich seitdem ente gesammelt haben wir haben in dem laufe der mission jetzt diese segmente über eine gesamteabfolgefrisiert und sie können sich das vorstellen dass ein setting mentor logg geologie in gestein schichten liest wie in seiten von einem buchjohn krozingen der ursprüngliche prinzip der mission er hat das immer sehr schön eben mit dem buch verglichen dass sie mit jeder schicht die sie untersuchen eine neue seite in dem buch aufschlagen und.Damit wieder ein neues kapitel.Der geschichte diese die der geologisch und georg chemischen geschichte dieser landschaft ebenentdecken und was wir halt haben ist wir haben.Ton mineralöle was ganz ganz wichtig ist denn ton mineralöle äh haben nicht nur die eigenschaft dass sie sichnur in bereichen bilden wo wasser vorhanden ist sondern auch die eigenschaft dass sie zum einen.In verdacht stehen katholisch wirksam zu sein je nachdem wo man.Wen man fragt welche schule man sich anschaut wenn man den schritt machen möchte von vor biologische organische chemie zur biologie dann muss man gewisse dinge an einem ort konzentrieren in gewisser weiseausrichten um eben diese marco moleküle zu machen und eine schule sagt halt das ton mineral oberflächen katalysator wirken können um das so zu machendas heißt schon allein deshalb sind ton mineralöle sehr wichtig aber wenn sie.Mikroben haben wenn sie hier auf der erde sich beispiele anschauen äh nehmen sie ihre garten erde die bleibt im sommer feucht auch an trockenen tagen weil ton mineralwasser aufnehmen und wiedergeben können und wasser speichern können also diese in ton mineralöle generell sind sehr sehr wichtig um die etablierten einer umgebung zuzu fördern wir haben sehr viele soll fahrte gefundenwir haben gleichung gefunden wir haben bereicherung gefundenund von daher eine ganz variable georg chemie eine variable mineral logi e,aber dann auch wieder den sehr dementieren prozessen zugeordnet werden kann wenn sie sich irgendwelche ähm.Publikationen anschauen die äh veröffentlicht sind oder einfach auch nur auf.Webseite gehen dann sehen sie was eine sehen sie eine sogenannte strategie grafische tabelle und diese strategie grafische tabelle zeigt.Einzelne schichten die dann gröber könig oder feiner könig sind und gewisse eigenschaften haben,damit und verstehen wir die geschichte dieses ortes die geologisch geschichte dieses ortes und wir verstehen die entstehungsgeschichte dieses ortes.Und das ist was curiosity herausgefunden hat und immer noch dabei ist.
Tim Pritlove 1:24:50
Gibt es dann ja auch schon so so so maß zeitalter die daraus dann schon abgeleitet worden sind wie man das auf der erde kennt.
Susanne Schwenzer 1:24:57
Ja mahlzeit alter gibt's schon auch von den sachen die von satelliten beobachtet worden sind der mars wird eben eingeteilt in drei große zeitalter das enorm schien das experience und das,zonen dass amazon.Zeit in der eben oxidieren der oberflächen bedingungen herrschten so wie heute das.Ferien ist die zeit wo man lange zeit für vermutet hat das soll vater entstanden sind.Wofür wir uns hauptsächlich interessieren ist das nachher das ist diefrühester zeit auf dem mars von dem sogenanntenvor dem sogenannten happy bombardements bis zu ungefähr drei komma zwei milliarden jahre vor heute wo wir die entwicklung von fluss tälern gesehen haben wo die ganzen ton mineral entstanden sind und woalle hinweise sagen dass mars nass war wie warm wissen wir nicht genau aber auf jeden fall dass es fließendes oberflächen wassergab und das im prinzip lebens-Freundliche bedingungen geherrscht haben auf dem gesamt planeten und natürlich.
Tim Pritlove 1:26:10
Das bombardements ist also einschläge von entsprechenden asteroiden et cetera die auch auf der erde massenhaft runtergekommen sind zu einer zeit als halt noch sehr viel mehr loses zeug rumflog in unserem sonnensystem.

Susanne Schwenzer 1:26:23
Drei komma neun milliarden jahre vor heute gab es einen kurzen zeitraum und zwar hat.Zusammen hängt das damit zusammen dass die äußeren gast planeten ihrer orbit verändert haben und damit die asteroiden des kleinen material was wir haben,nicht mehr in gravitation stabilen orbit zwar sondern dadurch eben die arbeits verändert hat und einiges eben nach innen geschleudert worden ist die sonne ist.Größte gravitationdurch ideen wir haben das ist auf dem mond zu sehen das wäre auf der erde auch zu sehen wenn unsere erde nicht biologisch so aktiv wäre und inzwischen alles aus radieren hätte was damals entstanden ist und das ist eben auch in einigen terrasse auf dem mars noch zu sehen,nicht überall es gibt halt auch deutlich jüngere ähm geologisch jüngere bereiche auf dem mars aber was für die mission in die follower the water oder nach lebensbedingungen freundlichen gegen den suchen wir suchen die,die thomas die zwischen drei komma neun milliarden und drei komma zwei milliarden jahre alt.Und in dieses zeitfenster fällt halt geil der fällt an das ende des zeitfenster vom nachher in syrien also hat wahrscheinlich den übergang in die ich mehr trockene.Klima des maß gesehen und was wir jetzt machenist auch wieder wie auf der erde wir nehmen diese großen zeitalter und wir sehen was die steine vor uns sind und wir gehen schritt für schritt durch undordnen die steine die wir finden in gruppen in kleinere einheiten dann auch wieder strategie grafisch ein wie man sagt um.Festzustellen ums mal um auf mein beispiel mit dem buch wieder zurück zu kommen um festzustellen was es seit der eins und also seite fünfzig von dem buch wie gehört das alles zusammen das ist die,abfolge dieser geschichte wie müssen wir das erzählen damit es in der logischen korrekten reihenfolge ist.
Tim Pritlove 1:28:19
Und auch um dann entsprechend wenn man später andere bereiche ähnlich intensiv nochmal untersucht das dann auch leichter korrigieren zu können zu schauen so ah okay alles klar dass so wie es hier aussieht ist das wahrscheinlich jetzt dieses zeitalter und.Hier dieses diese dinge die gefunden worden die kurz erinnern gleichung zonen fiel jetzt gerade was nicht genau was das ist aber so das alles dinge von denen man erwartet hat dass man sie finden wird,und jetzt freut man sich dass man sie gefunden hat oder sowas alles überraschungsei funde wo man sich dachte so boah was das denn.
Susanne Schwenzer 1:28:53
Als geologie erwartet man vielleicht mehr als jemand der nicht geologie ist.
Tim Pritlove 1:28:59
Ja sicherheit.

Susanne Schwenzer 1:29:01
Wir hatten natürlich wir sind doch nicht gelandet ohne irgendwas zu wissen wir hatten intensive studien vom orbit gemacht das passiert schon wenn man die landesteile aussuchenin meinin diesem workshops da versucht da versucht man natürlich so viel wie möglich schon herauszuarbeiten was man von den satelliten aussehen kann das heißt wir hatten schon kartenvon dem und hatten unsere vermutungen was eben wo sein könnte das beste beispiel ist vielleicht hiermit halt wo wir vom satelliten aus bereits gesehen haben dass dortstärkerin den satelliten bildern zum tragen kommt und man sieht halt in den satellitenbild dann auch dass es eben eine logische erhöhung im gelände ist unddas dann auch vom boden aus zu untersuchen mit einem rover.Ist immer ein zusammenspiel dessen was man schon weiß und dessen was man dann auf dem boden tatsächlich wenn man dort rumfährt auch sieht es gibt überraschungen die erste überraschung war dass wir eben dieses kondome rat gesehen haben.Was nicht ganz,unerwartet kam aber dann doch auch überraschend direkt dort wo wir gelandet sind.Aufgetaucht ist aber das ist geologie sie haben eine gewisse auflösung vom satelliten wir wussten dass wir am ende,eines kanals sind der sich also in den in den katherin eingeschnitten hatte wo wasser in den kader reingeflossen war,dieses sogenannte fande postet gesehen also wenn wenn wasser aus einem steilen hang in eine flache rein kommt dann kann es nicht mehr alle materialien mit.Das heißt es werden dort materialien abgelagert sie sehen das wunderbar im vorhalten land wenn die bach läufe die steilen hänge runterkommen und dann eben sich ausbreiten und die rolle dort ablagert ähmähnliche prozesse das hat man natürlich vom satelliten gesehen dass dort eben ablagerungen stattgefunden haben dass man tatsächlich in soul sechsundzwanzig also sechsundzwanzig tage nach der landung bereits in konrad fotografieren kann war dann auch wieder eine wunderbare überraschung,also nicht unerwartet im sinne von was ist denn das und das hab ich ja noch nie gesehen aber,eine freudige überraschung ist eben dort so zu sehen wie wir 's gesehen haben und diese dinge auch die soll vater diese fahrt gänge wir wussten dass soll fahrte dort vorkommen das war eines der hauptziel der mission so fahrte zu findendass wir sie dort gefunden haben wo wir sie gefunden haben war ein bonus.Und so es ist expo ration man weiß einiges man hat karten aber man weiß nicht alles und.Anderes schönes beispiel ist gestein den wir sogar genannt haben wo wir trockenen risse gesehen haben.An dem sind wir erstmal im prinzip vorbeigefahren und wenn ich.Gefahren eine mission ist praktisch immer in bewegungund dann und die analyse der daten findet parallel statt das heißt manchmal,findet man eben etwas sozusagen im rückspiegel und zum old zucker sind wir dann nochmal zurück gekommen um eben zu gucken der hat trockenen risse trocken risse sind extrem wichtig weil sie sich.Nur bilden wenn wiederholt es nass werden und austrocknen stattfindet.Jeder kennt trocken risse der irgendwo lebt boston mineralöle gibt und wenn man eine pfütze hat und die trocknet aus dann bilden sich diese risse an der oberfläche aber die bilden sich nur durch wiederholt des nass und trockenwechseln.
Tim Pritlove 1:32:48
Das heißt man hat man auch im bezug auf die wasserfrei frage neue erkenntnisse gewonnen oder ist eigentlich schon alles bewiesen.

Susanne Schwenzer 1:32:59
Wir haben durch das kondome rat halt nachgewiesen dass wir das,dieser wasser kanal nicht ein.Kurzfristige es hat halt mal die kurzfristig geregnet dann mal alles wieder.Effekt ist sondern dass es ein effekt ist wo wasser über längere zeit geflossen sein muss der unterschied ist wenn sie eine sehr kurzfristiges wasser ereignis haben dann äh,kommen materialien den hang hinunter und sie die sind zerbrochen die sind scharfkantig und sehr stark unsortiert.Wenn sie einen langfristigen kontinuierlichen wasser strom haben,dann beginnen sie die steine zu runden und diese diese rundungsagt aus dass eben die das wasser über einen längeren zeitraum geflossen sein muss.Um eben rundung und sortierung zu erreichen und dass wir das dort so gefunden haben war.In gewisser weise neu es war nicht das erste mal wir sind auch nicht die erste mission aber es ist neu in dem sinne wie wärs jetztdort gefunden habenauf der anderen seite was wir jetzt machen können dadurch dass,eben die grundlagen in vieler sein sich gelegt sind ist mit größeren detail zu untersuchenund wir haben auch ein sehr größeres instrumentarium die organische chemie die wir mit sam machen die metall sachen die wir mit sam machen die atmosphäre untersuchungen die wir machen das sind halt alles sachen die.Sehr viel details detaillierter sehr viel intensiver jetzt mit dieser mission gemacht werden wenn er als es vorher passiert.Auf der anderen seite haben natürlich die spirit and opportunity rover auch hervorragende erkenntnisse geliefert von daher sind wir nievoneinander unabhängig sondern es ist immer ein.Zusammenspiel dessen was man schon weiß mit dem was man eben jetzt findet.

Tim Pritlove 1:35:07
Ich glaube ich hab 's eingangs jetzt gar nicht nochmal gesagt sag ich jetzt einfach nochmal beim also im gegensatz zu den mission vorher beim laboratory sind ja fest im team.Dabei und das auch von anfang an wie muss man sich so die arbeit.Vorstellen also das ding ist ja jetzt noch unterwegs man gewinnt jetzt am laufenden meterneue erkenntnisse oder man kriegt zumindest dinge vielleicht auch bestätigt die man bestätigt haben wollte oder eben auch das gegenteil also dinge passieren und einiges dürfte ja nun auf der liste auch schon abgehaktgewesen sein oder ist die liste so ewig lang dass man das ding dreißig jahre fahren bist du bis man die überhaupt bekommt also diese abstimmung so zwischen den engineer die halt die ganze zeit versuchen dieses gerät am leben zu erhalten.Und im wissenschafts team die sich die ganze zeit neue sachen einfallen lassen wie muss man mit diesen prozess vorstellen wie läuft das weil es ja jetzt sicherlich auch nicht nur die open air university dir beteiligt ist sondern es sind ja wissenschaftler round the world.

Susanne Schwenzer 1:36:07
Ja ja wir sind knapp dreihundert leute wenn ich's richtig im kopf habe.Auf der wissenschaftlichen seite und natürlich mindestens so viele ingenieure und nase leutewie man sich das vorzustellen hat ist wir sind in teams eingeteilt natürlich hat jedes instrument seine teams die dann auch wieder aus ingenieuren und wissenschaftlern bestehenund dann gibt es aber auch eine struktur so wie man das mit jedem anderen projekt.Man hier eine projekt struktur projektleiter wenn man's so übersetzen möchte ist zurzeit erschweren wasser war da der am pc ist und der das der als prinzipiell investigative hat das ganze über sieht und.In letztlich dann wohl auch die letzte entscheidung treffen müsste wennwie eine entscheidung strittig strittig wäre um ihn herum hat er ein team von anderen leuten die eben mischen sind und die das ganze dir die leitung des ganzen haben aber wie man irgendwie muss man sich das vorstellen von,wir machen long plans,pläne dessen was wir über den zeitraum von vier wochen sechs wochen acht wochen zehn wochen machen wollen,äh wir machen mit tom plans was machen wir in den nächsten drei bis fünf tagen und wir machen das was wir.Nennen also was machen wir heute das ist also die struktur die planung struktur,über dem ganzen was wir mit longdrink mit plans machen steht natürlich das was die mission erreichen möchte die mission goes charakterisiert die umgebungcharakterisiert die tabelle.Und alle diese punkte die.In dem missionswerk ziel festgeschrieben sind das ist unsere leitlinie und dann gibt es die sogenannten planer die haben daswirklich im kopf und die achten da drauf es ist auch immer wichtig zu gucken welche ressourcen wir haben also,energie datenmengen alle diese dinge aber auch die ressourcen wenn sie daten bekommen ziemlich kurzfristig vor ihrem nächsten planungwie viel können sie in der zeit.Das wiederum zum satelliten schicken müssen überhaupt leisten,im bezug auf planung das also komplexität genannt wird.Ist das zusammenspiel dessen was man eben erreichen kann an jedem tag ich bin bei der taktik planung planung beteiligt.Das heißt die entscheidung zu treffen was machen wir heute.Und das wird angeleitet von denen die die die längeren längerfristigen pläneim kopf haben und es finden sehr viele diskussionen statt und mit den leuten mit den instrumenten teams mit den ingenieuren um festzulegen was können wir mit den heute vorhandenen ressourcen in der heute vorhandenen zeitmachen das eben in dieses konzept passt dessen was wir hier an geld gerader machen wollenda wir aber den ganzen krater zur verfügung haben wenn wir eine mission hätten die so lange lebt wie opportunity und würde es uns mit sicherheit nicht langweilig.
Tim Pritlove 1:39:38
Und ist das absehbar dass es so lange hält bisher geht's ganz gut ne.
Susanne Schwenzer 1:39:41
Einen bisher geht's ganz gut für finger prost wie man so schön im englischen sagt.Die wir haben einen unterschied wir haben keine solar panels wir sind also nicht solarbetriebenen sondern wir haben dieses.Also ein radioaktive energiequelle und die haben natürlich eine lebenszeit soweitich es im kopf habe sind's vierzehn jahre wo man eben genug energie hat um den robert warm zu haltenund sinnvoll zu betreiben aber das wir sind natürlich mit unseren fünf fünfeinhalb jahren noch ziemlich am anfang und von daher haben wir noch ein bisschen weg strecke vor uns.
Tim Pritlove 1:40:22
Aber kann durchaus sein dass es auch seine vierzehn jahre schafft ja.
Susanne Schwenzer 1:40:28
Ich hoffe doch also in robert zu fragen wie lange er lebt das wäre so gut wie menschen zu fragen wie lange lebt und das thema wollen wir lieber nicht anschneiden.
Tim Pritlove 1:40:40
Aber was auf jeden fall klar es ist,rover sind zumindest was die maß betrifft einfach ein extrem erfolgreiches konzept also man hat einfach gesehen darüber es lohnt in den aufwand weil die komplexität des geräts ist,enorm also was da alles feuer getestet werden muss und zusammenspielen muss damit es eben dauerhaft läuft mal ganz abgesehen von der durchgehenden begleitung und betreuung und dem fixen vonproblem die halt auftreten wenn man während man das alles betreibt zeigt dass diesen aufwand lohnt.Weil man eben einfach die möglichkeit hat durch diese bewegung ganz andere bild von diesem planeten zu bekommen.
Susanne Schwenzer 1:41:23
Es kommt immer darauf an was sie wollen inside der länder den man ja schon mal erwähnt haben ist eine seis mische station das heißt der ist darauf angewiesen dass eben möglichst in ruhe.Auf der oberfläche zu sitzen um ein maß erdbeben zu entdecken wenn man das machen möchte dann braucht man keinen robert.
Tim Pritlove 1:41:44
Beziehungsweise wenn ihr jetzt so viele robert noch hinterher kommen sowie straßenverkehr stattfindet die erdbeben nicht mehr messen.

Susanne Schwenzer 1:41:52
Ne damals ist groß und die gefahr dass rover mit urban kollidieren ist noch lange nicht gegeben ich glaube.Engländer würden jetzt sagen das problem.Nee aber mal ernsthaft gesprochen man muss sein instrument danach aussuchen was man wirklich machen möchte dashängt damit zusammen was die untersuchungen sind das hängt damit zusammen wie langlebig man ist wenn man zum beispiel,felix denkt der ja in der pool region gelandet ist wo es im winter.Über friert die zeit die der gehabt hätte wäre eben nichtgenug gewesen um eine größere.Fläche zu erkunden von daher macht ein land der dog sinn auf der anderen seite wenn sie den robert haben wie sie richtig sagen man kann eine gewisse strecke untersuchung man kann die perspektivetiefe verändern man kann ein größeres areal untersuchen und wenn man jetzt ein exot mars anschaut man kann natürlich auch.Sich dann eine,optimale stelle aussuchen wenn man landet dann ist man darauf angewiesen dass man genau dort landet wo man landen möchte um seine untersuchung zu machen wenn man einen rover hat,kann man von der landesteile in zum beispiel etwas komplexes teurer fahren wo die geologie das bietet was man eigentlich untersuchen möchte aber wo das die komplexe,so wäre dass man ebennicht landen kann aus sicherheitsgründen und alle diese möglichkeiten bietet ein rover aber letztlich wenn ich eine mission zu planen hätte wäre die erste frage was will ich überhaupt,was brauche ich.
Tim Pritlove 1:43:32
Und was braucht man es gibt ja.Wenn man jetzt mal ein bisschen in die zukunft schaut was künftig jetzt für mission geplant sind dann wird der straßenverkehr doch schon zunehmen also als nächstes ist,thomas am start in dem fall mal eine mission der esa und ich glaube auch die erste mission dieser art für die esadas erste mal dass so ein opa gebaut wird und man sich quasi des maßes mal wirklich auf dem boden annimmt dieganzen isa mission die halt im orbit agieren die waren alle sehr erfolgreich und da hat die ist er ja auch schon viel erfahrung gesammelt jetzt wird sich das einstellen und ich glaube auch die nasa ist schon wieder drauf und dran den nächsten robert zu bauen.
Susanne Schwenzer 1:44:14
Und masterselbst hatte aber andere instrumentedes cam ist dann mit einem rahmen instrument kombiniert ab jetzt es ist nicht dabei diesmalund äh wir haben auch keinen sam und kein kevin dafür haben wir maxi wer das ist ein instrument das sauerstoff aus der maß atmosphäre generieren möchteund wir werden auch proben nehmen aber das ist auch wieder so ein schritt in sachen proben zurück.Die erde zu bringen ist trendy der erste der eben dann mal die proben name übt.Und äh dann wird als nächstes.Ein rover wahrscheinlich konzipiert der dieses diese proben behälter holt.Oder auch nicht das kommt dann eben darauf an wie erfolgreich das war.
Tim Pritlove 1:45:13
Also man sammelt jetzt auf jeden fall schon mal probe und danach macht man sich gedanken über die vielleicht auch eingesammelt bekommen zu sagen um die dann wieder zurückschicken zu können.
Susanne Schwenzer 1:45:20
Geben gehen wir mal zurück auf die apollo mission die apollo mission hat auch alles schritt für schritt gemacht da wurde auch erst einmal zum beispiel das dockin geübt und so weiter und in dem selben sinn äh wird jetzt mal proben name gemacht,weil da müssen technologietechnologische probleme gelöst werden da müssen auch entscheidungsfindung probleme gelöst werden und da müssen probleme von planetkey protecting gelöst werden und von daher ist das ein erster schritt.
Tim Pritlove 1:45:48
Was heißt das planen welcher planet so jetzt geschützt werden die erde weiter.

Susanne Schwenzer 1:45:53
Planet protecting geht in beide richtungen planet protecting in richtung mars ist ähm natürlich sehr wichtigdenn wenn wir bakterien von der erde mitbringen würden und auf dem mars verteilen dann könnten wir nie mehr herausfinden ob es originale maß bakterien gibt.Von daher ist es sehr sehr wichtig dass wir jedes jede mission die wir schicken entsprechend.Anschauen wo geht sie hin.Was wird sie machen wird sie mit potenziell mit wasser in kontakt kommen ja oder nein.Planet protecting nach dem sogenannten kostbar protokoll nach.Außen hin beachten aber natürlich ist das hereinbringen von proben.Auf die erde genauso wichtig dass man eben sich ganz genau im klaren ist wie man diese.Aus arbeitet und da gibt's experten wir sind von hier von der open air university.Mit unserer astro biologie gruppe ein ganz ganz kleines bisschen daran beteiligt,sowohl äh damit dass wir gerade eine gruppe aufbauen die sich.Eben die erstellung von diesen richtlinien bemüht.Als auch dass wir biologen haben die eben äh beraten tätig sein können in diesen gremien um zu sagen was mikroben können und was sie nicht können.Und das sind internationale gremien internationale bemühungen da ist keiner alleine sowas kann man nur machen wenn sich alle einig sind.
Tim Pritlove 1:47:26
Da wäre es auch ein bisschen blöd wenn man dann auf die auf einmal seine kamera einschaltet und man sieht so tierchen dies irgendwie auf dem mars geschafft haben die kleinen bücher sind ja bemerkenswert widerstandsfähig und ich glaubewas ist die würde man wahrscheinlich auch tatsächlich bis zum maß bekommen würden dann irgendwie immer noch.

Susanne Schwenzer 1:47:43
Ja dass ich mein da kommen wir jetzt auch in den großen bereich der sogenannten pannen wo ja leute sich damit beschäftigen was,an mikroben könnte es von einem planet auf den anderen schaffen.Die andere frage ist ja nehmen wir mal an wir hätten hypothetisch des großes hätten äh leben auf dem mars könnte leben auf dem mars angefangen haben und die erde sozusagen infiziert worden sein.Das ist das konzeptanja und eines der argumente ist mars ist kleiner wenn sie jetzt sich vorstellen dass ich maß und die erde als,planeten parallel gebildet haben dann wäre der markus schneller abgekühltgewesen um zum beispiel wasser auf der oberfläche zuzulassen einfach weil er kleiner ist und das heißt leben könnte wenn man diese,zeit betrachtet und die abfolge betrachtet rein theoretisch eventuell dort zuerst stattgefunden haben.Und dann durch meteoriten.Die erde gekommen sein und da gibt es eine ganze forschungs- disziplin die sich damit beschäftigt welche der verschiedenen mit mikroben von flechten algen bakterien.Oder auch eben die bär tierchen was könnte so eine reise überstanden haben denn es ist kalt es ist trocken und es isthohe kosmetische strahlung wer könnte.Hundert millionen jahre im weltall überleben und auch den einschlag überleben die drücke und die temperaturen überleben an dem einschlag.Das was raus fliegt hat nicht unbedingt,geschmolzen gestein gesehen im ganzen wir wissen von den athleten ne dass die eben keine schmelzen anschlüsse haben dass die maximal zwanzig gigawatt pascal gesehen haben.Und damit auch nicht so hoch erhitzt worden sind also wer könnte in diesem gesamtenflecht werk von bedingungen dass wir jetzt kennen es eventuell von maß der erde geschafft habe,und das ist ein ganz großes thema und auch ein ganz spannendes thema wie ich finde.
Tim Pritlove 1:49:54
Klingt auf jeden fall bemerkenswert,bärtchen also unglaublich resistent weiß man das mittlerweile.
Susanne Schwenzer 1:50:02
Man schon ich nicht äh keine kann ich mal gerade meine kollegin.
Tim Pritlove 1:50:03
Meine kollegin also zwischen ein gut erforscht das feld.
Susanne Schwenzer 1:50:10
Es ist ein guter forscht des feld und was bakterien meistens ähm widerstandsfähig macht ist dass sie ihre diana gut reparieren können oder dass sie,auch mechanismen haben sporen zu bilden das heißt sieleben dann nicht im sinne von dass sie sich teilen und aktiv am leben teilnehmen sondern sie bilden diese sporen die geschützte kapseln sind in denen siedie widerlichen bedingungen überstehen können und sobald die bedingungen sich,eben wieder anfangen sich zu teilen und ganz normal ihrem leben nachzugehen.
Tim Pritlove 1:50:45
Schau mal vielleicht nochmal ganz kurz auch nochmal auf das esa,projekt also wir haben jetzt gesprochen und ich versteh das so im wesentlichen all zugcuriosity zwei selbst gerät aber andere.Andere bestückung sozusagen aber wahrscheinlich wieder selber lande system und so weiter weil er hat ja alles schon mal funktioniert muss man nicht komplett neu erfinden macht sich ja immer ganz gut in der raumfahrt wenn man irgendwas wieder verwenden kannwas sind jetzt die ziele von thomas und wir sind da die chancen der isa da aufzuschließen.

Susanne Schwenzer 1:51:17
So die die ziele von examen sind hauptsächlich eine zwei meter tiefe bohrungnatürlich wird thomas auch erstmal seine geologisch umgebung charakterisiert denn das ist das allerwichtigste zu wissen wo man eigentlich ist in der theologischen geschichte des mars das äh dafür haben gibt's kameras und so weiter und so fort.Aber das wichtige ziel ist zwei meter tief zu bohren warum.Die wenn man den maus sich als planeten anguckt und mit der erde vergleichtder unterschied ist die heutige atmosphäre die heutige amazon hat sich sechs bis zehn minibar das heißt es ist sehr sehr viel.Dünner niedrigeren druck als der erdatmosphäre mit ihren tausend dreizehn minibar.Und das bedeutet das mars und die maße oberfläche nicht.Abgeschirmt sind von der kosmetischen strahlung das geht mit ovg los hier auf der erde war das große thema das ozonloch und dass man zum beispiel in australien in sehr viel mehr strahlung abbekommt mars hat überhauptso eine atmosphäre das heißt ovg strahlung erreicht,boden praktisch unverändert andere kosmetische strahlung erreicht den boden praktisch unverändert das heißt wenn sie organische strukturen an der oberfläche habendann werden die verändert oder ganz zerstört dadurch einfach dass die strahlung herrscht das oxidieren die bedingungen herrschen die auch wiederum von der strahlung,erzielt werden.Wenn man also auf der oberfläche organic findet curiosity hat oberflächen organic gefunden dann finden sie dort hauptsächlich.Die dinge die sehr widerstandsfähig sind oder die sich,oder dinge die sich in seine widerstandsfähiger moleküle umgewandelt haben das lässt aber nur sehr bedingt einen rückschluss darauf zu was das mal gewesen ist wenn man jetzt feststellen möchte ob man lebens spuren hat.Stimmen natürlich hauptsächlich die original moleküle finden dazu muss man aus diesem bereich wo die strahlung wirksam ist rausgehenund deshalb bohren wir weil zwei meter das ist so ungefähr die abstauben tiefe vor so ziemlich alles was an galaktisch und kosmetische strahlung reinkommen,und deshalb möchte thomas eben bohren.
Tim Pritlove 1:53:30
Und bohren haben wir ja schon gehört ist gar nicht so einfach.
Susanne Schwenzer 1:53:33
Ja gut die dieses mol der hämmert ja und bohrt nicht.Und der hat auch nichts was von oben widerstand leistet ich hab's jetzt auch nur in der presse gesehen aber soweit ich weiß versucht man ja jetzt mit dem greift kaum von oben ein bisschen widerstand zu leisten das ist natürlich was,anderesim vergleich zu dem thomas rover der eine große sogenannte box vorne dran hat also ein ein bor geschenke so wie man das auch hier auf der erde kennt von den bohrungen die wir hier auf der erde machen wo der gesamte rover eben das gegengewicht bildetdem was man vorne macht es ist eine ganz andere technologie das können sie nicht vergleichen.Und es ist auch ein ganz anderes ziel weil wir wollen ja nicht nur diesen sensor in den boden hämmern.Belassen und mit ihm eine ebene baumen fluss messungen durchführen sondern es sollen ja diese drill die diese kerne die dort geburt die kerne die dort entstehen auch in den rover.Eingebracht werden und mit rahmen und moma untersucht.
Tim Pritlove 1:54:40
Wo man auch wieder wunderbar das zeitalter ablesen könnte dem anderen dingen.
Susanne Schwenzer 1:54:46
Also die mineral energie und die organische chemie.
Tim Pritlove 1:54:49
Genau einfach mal gucken ob zwei meter unter dem maß doch noch irgendwelche pärchen schlummern.Der maß lässt alle nicht in ruhe gibt glaube ich,kein anderes objekt im sonnensystem was ich ähnlicher beliebtheit erfreut das hat ja auch was mit zu tun dass man alle zwei jahre die möglichkeit hatte auch mal eben schnell,hinzu reisen weil sich dann halt immer maß und erde in ihrem zyklus um die sonne.Recht nahe kommen sodass eben dieser dieser zugang auf weitere zeit.Bestehen wird ist davon auszugehen dass es wirklich alle zwei jahre immer wieder eine schippe draufgelegt wird.
Susanne Schwenzer 1:55:33
Das kann ich ihnen so nicht beantworten denn das ist eine frage der.Die von sehr vielen faktoren auch politischen faktoren abhängig ist äh sie haben also.Zum einen die wissenschaftlichen fragen es gibt wissenschaftliche natürlich konkurrenzzum beispiel wenn man jetzt im bereich der astro biologie bleibt und der frage sind wir eben alleine,dann sind die also die eisbärenmonde von jupiter und saturn auch ein ziel dass sehr viel weiter außerhalb liegt sehr viel schwieriger,zu erreichen ist sehr viel schwieriger auch für die untersuchungen.Sie ist denn sie können doch zwar auf der oberfläche landen sie haben aber wesentlich geringere sonnenlicht ein strahlung es.Es ist eben ein sehr viel schwierigeres terra es dort zu erforschen und.
Tim Pritlove 1:56:29
Aber sie haben wasser fontänen das muss man.

Susanne Schwenzer 1:56:32
Fontänen und aber das was man natürlich als wissenschaftler eigentlich möchte ist mal gucken was unter dieser eisschicht eigentlichist und dann kommen sie in alle möglichen schwierigkeiten aber das mal beiseite gelassen.Es ist eine politischefrage eine frage des geldes eine frage dessen was jede mission findet der inspiration der öffentlichkeit und ist ein so komplexes thema dass ich.Hoffen würde wir fliegenzwei jahre aber nicht mit sicherheit voraussagen kann was geschehen wird weil das hängt auch zum beispiel davon ab ob thomas sicher landet oder nicht was dann danach passiert und es hängt davonwas die europäische union als solches.An entscheidungen trifft was sie machen möchte möchten wir zu den also die esa jetzt möchten wir die simons erforschen oder äh wie ist es mit dem marko venus ist einvöllig nicht erforscht der planet die russen sindpaar mal gelandet haben da wunderbare sachen gemacht daten erforscht wollen wir mal zur venus das sind alles dinge die im kollektiv getroffen werden und von so vielen dingen abhängig sind das ist kaffeesatz lesereise wäre wenn ich jetzt hier eine.

Tim Pritlove 1:57:49
Ja ich wollte gar nicht das nur auf die isa bezogen wissen weil nasa hat ja auch noch andere ziele darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinausder maß beschäftigt uns ja mehr als nur wissenschaftlich ist ja sozusagen so ein mystische ort und vor allem ist ja auch so sagen wir mal der nächste kandidat für wieder so eine über anstrengung wo man mal alles einsetzen und sagt okay wir wollen jetzt mal wirklich mitmenschen.Zum maß fliegen und wir wollen sozusagen das einfach mal machen und zwar einfach einfach einfach immer wieder was,zu haben was man bisher noch nicht gemacht hat das scheint uns menschen ja irgendwie so ein bisschen in die wiege gelegt zu sein so etwas zu tun,was mich jetzt frage ist,wie gut sind wir denn jetzt vorbereitet also wieviel wissen wir denn jetzt schon um diese rahmenbedingungen einer eines eines maß fluges mit menschenweil es mal ganz abgesehen von den rahmenbedingungen von raketen transport et cetera aber einfach nur was sozusagen was das verständnis des des planeten als solchen betrifft figur,vorbereitet um dort auch sein zu können und im idealfall natürlich auch wieder zurück zu kommen.

Susanne Schwenzer 1:58:55
Wir wären eigentlich sehr gut vorbereitet aus der wissenschaftlichen sicht denn äh wir kennen einige stellen recht gut aber jetzt malmeine ganz persönliche meinung und nicht die meinung von nasa esa oder irgendeiner anderen raumfahrt behörde.Das ganze thema ist sehr sehr viel komplexer wenn man sich das anschaut und mit dem mond vergleicht.Wenn wir zum mond fliegen sind wir nahe wir sind in drei tagen wieder zurück egal was passiertapollo dreizehn wäre um den maus nicht möglich weil sie monate unterwegs sind das heißt das risiko ist höher ich bin mir nicht sicher ob unsere gesellschaft heutetage noch dasselbe verständnis von helden hat und von risikobereitschaft dass wir damals hatten das ist aber jetzt eine ganzepersönliche meinung auf der anderen seite wir kennen die geologie sehr gut wir wüssten was wir dort zu tun haben wir kennenzum beispiel von von den messungen die curiosity mit seinem relation textur macht sehr genaudie strahlend dosis die wer bekommen also die nase bereitet ja im prinzip mit dem radio.Curiosity mit maxi auf mars zwanzig zwanzig gewisse dieser schritte vor also der wille scheint da zu sein wenn man es so von außen betrachtet,für mich ganz persönlich da hier in der astro biologie gruppe arbeite sehr viel mit biologen zusammenarbeite.Denk ich ist es aber auch ganz ganz wichtig dass wir planet radio action also den schutz des planeten maß,an erster stelle stellen denn wenn wir mit einer bemannten raum mission dortankommen dann bringen wir zwangsläufig uns mit wir können uns nicht so sterilisieren wie manin stück metall sterilisieren kann und aus aus der sichteines mit den biologen zusammenarbeiten denn wissenschaftler s wäre es halt auch ganz wichtig dass wir dieses return haben dass wir eben erstmal uns anschauen könnenist da überhaupt was an der stelle wo wir landen wollen denn wenn man das einmal kontaminiert hat wir kennen das von der erde wenn man die wenn man ein.Ökosystem eine oder auch eine landschaftohne irgendwas drin erst einmal kontaminiert hat kann man das nicht mehr rückgängig machen also von daher ganz persönlich gesehen wäre die erforschung dessen obob es tatsächlich bio biologische rückstände gibt ja oder nein und zu wissen sicher zu wissenworauf man sich in dem bereich einlässt halt auch ganz wichtigaber auch das wiederum ist eine entscheidung die im kollektiv im internationalen kollektiv abgewählt werden muss was man jetzt machen möchte.
Tim Pritlove 2:01:52
Also eher ein plädoyer für weitere robotik mission um einfach mal was rausholen was wäre denn wenn man so ein sample tatsächlich zurückgeführtbekommt wie viel besser könnte man denn diese bodenproben auf der erde untersuchen im vergleich zu dem was derzeit das ems l leistet.

Susanne Schwenzer 2:02:11
Sehr viel besser denn sie haben hier auf der erdealle möglichkeiten nehmen wir eine ganz ganz einfache möglichkeit wenn ich ein stück stein hier auf der erde habe,kann ich als geologie einen sogenannten dünn schliff machen das heißt ich kann mir ein dreißig mikrometer dünnesvon dem herstellen das auf ein glas träger aufgebracht wird und ich kann dann in mikroskop untersuchen wie mineralöle im verhältnis,zueinander stehen.Das können wir auf dem mars derzeit nicht das heißt ich kann zwar feststellen ich habe ein soll fat und ich habe ein box ich ich kenne aber nicht die die ganz genaue,das ganz genau verhältnis der beiden und die textur wie die beiden miteinander verwachsen sind oder eben nicht miteinander verwachsen sind wo ich als geologie in einem dünnen schliff hier auf der erde sofort sagen kann die sind zusammen entstanden,oder erst war das soll fat dann war der heimat it oder umgekehrt das kann ich im auf dem mars nur macros kopie in den kamera aufnahmen aber nicht mikroskopischendas ist nur eines von ganz ganz vielen beispielen.Aber gehen wir mal zurück zur apollo mission mit der ich schon mehrfach beispiele gebracht habe apollo hat proben zurückgebracht wir haben gerade jetzt in den letzten wochen.Apollo proben geöffnet die noch nie geöffnet waren warum hat man die so archiviert man hat die so archiviert.Uns allen klar ist dass sich die technologie weiterentwickelt das in der zukunft untersuchungen möglich werden auf.Basis von erkenntnissen die wir zu dem zeit als die apollo proben zurückgebracht wurden noch nicht hatten technologische möglichkeiten aber auchhypothesen weiterentwickelt werden die man dann in der zukunft klären kann und das ist etwas dass man eben nur,die wir hier auf der erde haben und die wir hier archiviert haben leisten kann denn curiosity arbeitet heute.Die proben die wir zurückbringen würden wer da von denen wäre auch in fünfzig jahren in hundert jahren noch etwas dafür.Für wissenschaftler die dann ganz andere fragen und ganz andere instrumente haben um diese proben zu untersuchen.Und das ist für mich eines der größten argumente und apollo hat uns gezeigt.
Tim Pritlove 2:04:27
Und wenn diese argumente auch in der diskussion und zukünftige missionen eingebracht.
Susanne Schwenzer 2:04:31
Soweit ich das höre ja.
Tim Pritlove 2:04:33
Ja ist ja dann sozusagen auch immer noch einiges zu machen und zunächst einmal wäre es ja eigentlich auch ganz sinnvoll erstmal so eine mission zu machen weilüberhaupt erstmal vom maß zurückzukehren ist ja in dem sinne auch noch nicht gelungen beziehungsweise auch noch nicht so richtig versucht worden.Weil es ist ja nun also makler kleiner sein als die erde aber hat ja trotzdem eine ganze menge masse spricht um die gravitation,erstmal zu überwinden um von dort wieder zurück zu kommen auf jeden fall auch nochmal eine große herausforderung.Ja das war so ein bisschen ans ende der sendung angekommen gibt's ja noch etwas.Ja allen zu hören denn noch mit auf den weg geben möchte was wir vielleicht bisher noch nicht angesprochen haben.
Susanne Schwenzer 2:05:15
Das einzige was ich halt finde ist wenn man in einer position ist wie ich es es ist eine der besten dinge die einem so passieren können und ich nehme mir da das zitat von steve immer sehr zu herzen der einfach sagt in joyder menschen.
Tim Pritlove 2:05:31
Ich habe das ja auch sehr genossen vielen vielen dank frau schweizer für die ausführung zu der boden erkundung auf dem mars.Ja und wie immer vielen dank natürlich auch fürs zuhören hier bei raum zeit im nächsten monat geht's dann wieder weiter mit irgendwas anderem sehr interessanten bis dahin sage ich tschüss.
Shownotes
Die Bedeutung chemischer Prozesse bei der Entstehung von Sternensystemen und dem Leben
 Die Astronomie scheint ein Spielfeld für Physiker zu sein, doch Chemie spielt im Kosmos auf allen Ebenen einen Rolle: Von der Entstehung protoplanetarer Scheiben, der Zusammenballung junger Planeten, über die Herausbildung planetarer Schalen bis zur Entstehung der Bausteine des Lebens: Kosmische Chemie ist unerlässlich, um das Universum zu verstehen.
Die Astronomie scheint ein Spielfeld für Physiker zu sein, doch Chemie spielt im Kosmos auf allen Ebenen einen Rolle: Von der Entstehung protoplanetarer Scheiben, der Zusammenballung junger Planeten, über die Herausbildung planetarer Schalen bis zur Entstehung der Bausteine des Lebens: Kosmische Chemie ist unerlässlich, um das Universum zu verstehen.
Astrochemiker ergründen das All auf verschiedenen Wegen: Spektrale Analysen erlauben schon lange, chemische Elemente auf fernen Sternen, in Gaswolken oder auf Planeten zu bestimmen. Gesteine von Meteoriten oder vom Mond erlaubten Laborexperimente. Zunehmend reisen auch verkleinerte Massenspektrometer ins Sonnensystem. Bei kleinen Körpern wie Kometen und Asteroiden geht es dabei um die Suche nach unserem Ursprung: Woher kamen Wasser und Bausteine des Lebens auf die Erde?
Dauer:
1 Stunde
42 Minuten
Aufnahme:
18.09.2019

Kathrin Altwegg
|
Wir sprechen mit Kathrin Altwegg, Astrophysikerin und emeritierte Direktorin des Center for Space and Habitability am Physikalischen Instutut der Universität Bern. Kathrin Altwegg entwickelte die Software für das Massenspektrometer an Bord der Sonde Giotto, die dem Halleyschen Komenten auf den Leib rückte und war als Principal Investigator des Instruments Rosina im Rahmen der Mission Rosetta zum Kometen Tschurjumow-Gerassimenko hauptverantwortlich für die chemische Untersuchung des Kometen.
Wir sprechen über die zunehmende Bedeutung der Chemie bei der Erforschung des Universums, ihrer Rolle bei der Entstehung des Sonnensystems und was wir als Leben ansehen und dieses an anderen Orten im All zu entdecken gedenken.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript
mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert.
Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern.
Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort.
Formate:
HTML,
WEBVTT.
Transkript

Tim Pritlove 0:00:34
Hallo und herzlich willkommen zu raum zeit dem podcast über raumfahrt und andere kosmetische angelegenheiten mein name ist Tim Pritlove und ich begrüße alle zur neunundsiebzigsten,ausgabe von Raumzeit des neunundsiebzigsten gespräch,und ja ich sag in letzter zeit immer so schön raumfahrt und andere kosmetische angelegenheiten,heute gehts definitiv um andere kosmetische angelegenheit und vielleicht in gewisser hinsicht sogar um die kosmetische angelegenheit,schlechthin heute wollen wir nämlich sprechen über die chemie die cosmo chemie oder auch cosmos chemie kann man sicherlich auf die eine oder andere art und weise bezeichnet,letztlich die frage nach allem was jenseits der physik das universum so zusammengetragen hat,wie wir es heute vorfinden und,was auf die grundlage ist für unser leben und um doch aber mal ganz ausführlich zu sprechen,in die schweiz gefahren konkret nach bern an die universität bern an das physikalische institut,das hat nämlich dann noch ein center auf space and the city und,bis vor kurzem vor zwei jahren war kathrin alt weg die direktorin dieses centers und von daher begrüße ich sie auch herzlich hallo frau.War richtig zusammengetragen vor zwei jahren haben sich dann sein lassen aber sie haben's lange betrieben oder.
Kathrin Altwegg 0:02:09
Sehr lange direktorin weil das wurde gegründet im zweitausendelf weil wir eben sehr erfolgreich waren im weltraum forschung hat die uni da mehr geld locker gemacht,da hat man dieses zenter gegründet was eigentlich für intensiv arbeiten steht,also wir haben mit training bio chemiker gelogen aber dann auch theologen und philosophen zusammengearbeitet.
Tim Pritlove 0:02:38
Also ging es gar nicht mal nur um chemische fragen sondern eigentlich um alles.
Kathrin Altwegg 0:02:44
Eigentlich das leben und den ursprung des lebens also woher kommen wir wohin gehen wir und sind wir alleine.
Tim Pritlove 0:02:51
Das klingt nach einem ganz guten leid motiv für unsere heutige sendung,bevor wir da einsteigen würde mich aber natürlich erstmal interessieren wie sind sie denn zu diesem thema oder beziehungsweise überhaupt zu allem was mit chemie und raumfahrt zu tun hat gekommen,war das schon immer so in ihrer dna oder was er zufall gibt ja beide geschichten.
Kathrin Altwegg 0:03:19
Es war wahrscheinlich schon eher zufall also ich habe gerne naturwissenschaften ich bin auch aus einer,wissenschaftlichen familie ich habe aber lange überlegt ob ich euch logisch studieren wollen,physik entschieden und hab festgestellt musik gemacht als schwerpunkt den würde man heute technologie.Haben in basel die sortiert zusammen mit meinem mann,haben uns kennengelernt sind dann zusammen ins ausland nach new york für zwei jahre.Immer noch auf diesem gebiet und dann hoffen wir,grafisch am selben ort abgesucht und das war ein paar zufall in bern,ein job an der universität in forschung in der telekommunikation und die firma in der telekommunikation für jeweils unvorstellbare eine frau anzustellen zu dir.
Tim Pritlove 0:04:24
Aber haben sie dann doch gemacht oder.
Kathrin Altwegg 0:04:25
Nein ich habe dann meine mama angestellt und damit muss ich an die uni.
Tim Pritlove 0:04:32
Okay das ist jetzt wirklich zufall okay.
Kathrin Altwegg 0:04:36
Und so bin ich gelandet und ich sage immer die weltraum forschung hat mich gesucht nicht.
Tim Pritlove 0:04:42
Den eindruck macht das und womit hat sich dann die weltraum forschung zu dem zeitpunkt beschäftigen wird von welchem jahr reden wir jetzt von dann ging es los.
Kathrin Altwegg 0:04:49
Von neunzehnhundert,zweiundachtzig habe ich hier begonnen da habe ich zuerst begonnen mit magneten sphäre,unsere atmosphäre aber dann baut schon kam das projekt,der flug zum comedian harley,und das war eine sehr schnelle mission man hat so im einundachtzig,begonnen und das ist extrem kurz für eine weltoffene mission,und dann hatten sie dann personalmangel und sorgen sie umgepolt auf,vor allem die software gemacht.
Tim Pritlove 0:05:39
Lotto und rosita in kombination weil die beiden projekte hängen ja auch eng zusammen auch in ihrer vita hatte ich ja schon mal bei raum zeit ausgabe nummer zwanzig mit gerhard schwimmen besprochen derdamals durch der prinzipiell investigative warum ich das richtig erinnere für die ganze wissenschaft von.
Kathrin Altwegg 0:05:59
Projekt ist.
Tim Pritlove 0:06:01
Projekt den sehr wahrscheinlich dann auch,gut kennen ja das war ja breaking auf die esa damals ganz wichtiges ein erfolgreiches projekt der flug eben zu diesem,kometen eigentlich auch für den mythische,mythos besten kometen der zu dem zeitpunkt zumindest zu greifen war mag jetzt abgelöst worden sein im rahmen,aber das ging ja dann wirklich ziemlich ziemlich fix also sechsundachtzig war dann der vorbei flug was was war denn da ihre aufgabe.
Kathrin Altwegg 0:06:39
Verantwortlich für die software und dann für die datenanalyse.
Tim Pritlove 0:06:44
Also für die software von von was also.
Kathrin Altwegg 0:06:46
Von vom instrument dass man hier in berlin kann nicht sagen gebaut hat sondern koordiniert,zu der zeit war die schweiz schlecht finanziert für instrumente es waren.Massen spektrum meter hatte zwei sensoren das hieß und das hörst das hieß kaum effektiv von lindau deutschland vom herrn rosenbaum und das hörst kampf von.
Tim Pritlove 0:07:13
Was heißt es und hörst.
Kathrin Altwegg 0:07:14
Das es passt eben oder das heißt vom herrn rosenbaum und das hört von den gebaut,aber es sind noch die abkürzung dass eine heisst intensive sensoren und das andere.Und wir in bern stellt einen prinzipiell investigative professor und wir müssen das ganze trainieren und die instrumente wollten bei uns gerecht getestet.Und wir haben sie dann auch abgeliefert in kultur,ich war verantwortlich für alle software dieselben braucht um diese instrumente zu checken auftreten die software die damit geflogen ist sondern man,und damit war ich natürlich in sämtlichen test sinnvoll wird beim vorbei flug involviert bekommen wir die daten sofort,und nachher instrumente sehr genau komm.
Tim Pritlove 0:08:18
Da waren ein paar jahre mit.
Kathrin Altwegg 0:08:20
Ja also das war ja schnell fast siebzig kilometer pro sekunde geschwindigkeit vielleicht zwei stunden daten und wir haben da nicht zehn jahre ausgewählt.
Tim Pritlove 0:08:32
Das ist ein ganz gutes verhältnis ähm vielleicht in dem zusammenhang was muss man sich jetzt unter einem massen spektrum pop und diese beiden instrumente.
Kathrin Altwegg 0:08:47
Ein massen spektrum meter.
Tim Pritlove 0:08:49
Drum meter.
Kathrin Altwegg 0:08:51
Wir haben wirklich teilchen das kometen geladenen millionen massen spektakel,gemessen und zwar ihre masse bestimmt.Also die sind ins instrument reingeflogen und wir haben sie separiert nach ihrem masse mit magnet und elektrischen feld das kann man gerade nicht helfen.
Tim Pritlove 0:09:17
Also es war dann quasi so teilchen nachdem man an den kommenden vorbeigeflogen wäre.
Kathrin Altwegg 0:09:21
Während wir haben die koma gemessen die atmosphäre das.Das instrument separiert die dann nach wesentlicher nach gewicht.Und dann hat man am schluss ein massen spektrum also man hat zwölf das wäre ein stoff bei wasser oder ein zwei.Und und am vierundvierzig euro zwei und das war's schon ungefähr bei ehemals aus unserem maßen bereich hat dann aufgehört.Und wir hatten auch nicht eine sehr gute auflösung,zum beispiel ein zweites beide konnten wir nicht separieren.Aber wir haben gesehen dass der komet extrem viele moleküle teilt und eben auch schwerer.
Tim Pritlove 0:10:18
Und das war eine überraschung.
Kathrin Altwegg 0:10:19
Das war eine große überraschung ich meine wir sind mit schotter losgeflogen um zu zeigen dass das wasser hat im kommen.Und dass es einen festen kern hat derzeit immer noch nicht sicher ob das nur so eine am himmel oder ob es wirklich einen festen,das war das ziel von otto und wir haben sehr viel mehr erreichen.
Tim Pritlove 0:10:44
Dass es ja auf jeden fall belegt worden,bevor wir vielleicht mal so auf diese fragestellung kommen weil es ja immer so dieses okay was schaut man sich überhaupt an was man eigentlich wissen,müssen wir ja vielleicht mal ein bisschen zurückgehen und sich gedanken machen welche rolle eigentlich die chemie so spielt ich bin es kann auch was er sagt sie haben nur physik studiert,oder ist an dem noch ein chemisches studium gefolgt später.
Kathrin Altwegg 0:11:16
Nein ich habe im leben einfach.
Tim Pritlove 0:11:19
Ah im leben fach alles klar aber es ist so ein bisschen dann das haupt fach geworden über die zeit.
Kathrin Altwegg 0:11:24
Ja vor allem in den letzten jahren schon.
Tim Pritlove 0:11:29
Ja der weltraum unendliche weiten wie man die chemie spielt ja ihre rolle mein mann tendiert glaube ich immer so ein bisschen dazu über das weltall einfach immer so auf der basis von physikalischen,phänomen und gesetzen nachzudenken gravitation hält alles zusammen und dann fliegt es halt auch mal irgendwie auseinander und all diese ganzen physikalischen ereignisse,stehen so ein bisschen im vordergrund aber so diese die chemie sozusagen wird eigentlich nicht so oft diskutiert ist das jetzt nur so meine falsche sicht der dinge ist eigentlich ganz anders oder ist es auch ihre wahrnehmung.
Kathrin Altwegg 0:12:11
Ich glaube die auftrag ist ein relativ neues gebiet das ist der seit wenigen jahren dass man das beobachten kann von werte aus,und dass man sich gedanken darüber gemacht das material kommt aus dem unser universum unser sonnensystem unserer erde,noch reden bei,eine große diskussion und man hat gesehen dass wirklich.Vorhanden sind und seit dem man jetzt richtig gerade machen kann sieht man das auch,vor allem mit all meinen ziele sehen sie alle kühle überall im weltall und komplexer moleküle.
Tim Pritlove 0:13:00
Einmal das große teleskop oben fünftausend meter in der kama wüste der beste blick die man glaube ich so aus universum haben kann auf der erde zumindest wo ja ich glaube sechsundsechzig,gruppe zusammengeschnürt sind das ist natürlich eine enorme auflöst.
Kathrin Altwegg 0:13:16
Und das ist eben nicht optisch dass es dann in welchem bereich,und da sieht man wirklich moleküle.Man sieht den stern des sommers im stern drin stecken oder was immer mal anschauen.
Tim Pritlove 0:13:35
Jetzt sind ja moleküle im prinzip so die der fortgeschrittene zustand da hat sich ja dann schon mal überhaupt irgendwas zusammengebaut fallt,man tendiert ja erstmal dazu so die die welt einfach erstmal eine offene summe von atom zu sehen,angefangen hat ja mit dem,also das ist zumindest der aktuelle aktuelle sicht der dinge sagen wir es mal so mit dem ur knallen was auch immer davor gewesen sein mag und im wesentlichen bestand auf das weltall zunächst einmal nur aus wasser.Was wann,wann fing denn sozusagen chemie überhaupt erst an also,gab's ja dann sozusagen erstmal noch noch gar nicht oder weil wenn man da jetzt mal so salopp draufschaut war ja noch nicht ausgemacht dass das überhaupt so alles zueinander passt und sich so wild kombinieren kann.
Kathrin Altwegg 0:14:35
Sie haben recht oder im stand im wesentlichen wasserstoff ein bisschen helium bis juli zum sieben aber sonst nichts wäre,und dann haben sie sich diesen sterne gebildet und sterne sind eben fabriken für schwere atome.Und jetzt kommt so ein bisschen darauf an wie groß der stern ist unsere sonne die klein,die macht auch funktion weil in einem stern der besteht aus gas also wasserstoff im wesentlichen,und weil sterne so groß sind haben sie gravitation auf sich selber das heißt sie ziehen das gas zusammen bis eben die atomkraft so nahe kommen dass sie fusionieren können dem sagt man nukleare.
Tim Pritlove 0:15:19
Also weil die hitze einfach dadurch so enorm ansteigt unter dem eigenen gewicht wird alles zusammengepresst und bei den temperaturen kann dann die fusion überhaupt erst statt.
Kathrin Altwegg 0:15:28
Genau ganz genau und in kleineren sternen wir unsere sonne da,können sie kohlenstoff machen also drei sie machen zuerst mal,drei helium zusammen gibt an einen kohlenstoff dann ein helium dazu gibt sauerstoff und so können sie im prinzip das periode ein system aufbauen,mit einem und das hört dann auch beim eisen,weil eisen ist das beste gebundene hat den best gebundenen atomkrieg.
Tim Pritlove 0:16:00
Was macht das so so gut.
Kathrin Altwegg 0:16:02
Dann ist es energetisch in einem absoluten minimum und da kommen sie dann fast nicht mehr um weiter zu gehen wenn sie mal gelandet sind bleiben sie dort.
Tim Pritlove 0:16:14
Das heißt das eisen ist so sich selbst genug sozusagen das.
Kathrin Altwegg 0:16:20
Stabiles elemente hin genau.
Tim Pritlove 0:16:21
Strebt nirgendwo hin und was wäre dann der nächste schritt.
Kathrin Altwegg 0:16:27
Und es ist es gibt ja schweren elemente und die entstehen bei super nova explosionen.
Tim Pritlove 0:16:33
Egal wie groß ein stern ist nur durch dieses unter der eigenen last zusammen pressen des materials kann nicht mehr als eisen entstehen und das kann man ausrechnen.
Kathrin Altwegg 0:16:48
Das kann man als energetischen gründen ausrichten.
Tim Pritlove 0:16:51
Ok was ist denn dann sozusagen das nächste element jetzt hab ich 's perioden system gerade nicht so im aber alles was sozusagen darauf danach kommt braucht einfach mehr power und diese power gibt's nur durch explosion.
Kathrin Altwegg 0:17:04
Genau genau ein super noch einmal viel heißer,noch einmal viel höher und dann könnt ihr noch schwere elemente entstehen.Aber auch nur begrenzt nun die überreste der eine super das sind neue drohnen sterben.
Tim Pritlove 0:17:23
Kobalt ist der nächste.
Kathrin Altwegg 0:17:27
Dann gibt es neue drohnen sterne aus der super nummer und schönen haben ja nur noch neue tonnen und damit haben sie keine,auseinander treibenden kräfte mehr zwischen den geladenen teilchen und da kommt dann das material auch sehr nahe zusammen die neue.Sie sind also klein wegen dem aber extrem massen reich das kann jetzt auf keinsten volumen kann sehr viel masse haben,und jetzt neu dronen sterne die entstehen meistens im doppel der zweifel eins,die sind sehr häufig zu zweit es gibt zwei sterne und weil sie so maßen reich sind doch klein ziehen sie sich gegenseitig und irgendwann kommt zu kollision,und das sind dann kilo nova,in einer kilo sind die bedingungen noch einmal viel extreme und dann können sie die wirklich schwierig momente machen wie zum beispiel.
Tim Pritlove 0:18:26
Kein gold ohne neu dronen stark.
Kathrin Altwegg 0:18:28
Genau also kennt sie nicht zur bank kaufen sie sich zwei null.
Tim Pritlove 0:18:34
Ich hab schon ein schönes gespräch mit content tina aus mainz über neutralen sterne geradeeine woche bevor dann die große nachricht kam das erstmalig über die gravitationswellen genauso eine,hannover beobachtet werden konnte beziehungsweise man halt anhand der gravitationda gab's eine und dann auch,in der lage ja auch war dort genau hinzuschauen weil der dritte punkt mittlerweile existierte neben dem lego und ja dannwusste man hatte man erstmalig auch die bestätigung dass diese theorie auch hinhaut das heißt,das sind im prinzip die drei presst kammern unsere,atomaren gemengelage ja der normale stern der alles bis eisen erzeugen kann die super nora die dann bis was gibt's da eine größe die grenze auch so klar,in einer super nova passieren kann das hängt einfach von der größe des sterns ab in dem moment also da könnt ihr auch mal gold bei rausfallen oder ist es wird.
Kathrin Altwegg 0:19:40
Ja wahrscheinlich nicht aber es gibt elemente die kommen so super von kilo nova wie sogar von einem kleinen stern oder das verhältnis ist dann ein bisschen unterschiedlich.
Tim Pritlove 0:19:54
Aber super nova macht kein gold.
Kathrin Altwegg 0:19:56
Macht kein gold.
Tim Pritlove 0:19:57
Okay das weiß man ok also dafür brauchen wir dann die neue drohne sterne also diese extrem in sich zusammen gefallenen sterne und wenn die dann aufeinander treffen guter,dann haben wir sozusagen alles was das perioden system hergibt ich finde das irgendwie sehr erstaunlich dass,wir auf dieser erde ja eigentlich auch stimmt das eigentlich nahezu alles finden was wir auch im all sehen können.
Kathrin Altwegg 0:20:26
Elemente oder natürlich.
Tim Pritlove 0:20:30
Das heißt man kann eigentlich auch irgendwie davon ausgehen dass das bei anderen planeten auch so ist oder ist das eher zufall.
Kathrin Altwegg 0:20:39
Nein ich glaube das ist nicht zufall das ist so.
Tim Pritlove 0:20:43
Das heißt das ganze universum ist so dermaßen durchmischt und durch durch durch aber millionen von explosionen,schon eine einzige suppe von allem was das universum hergibt alles ist über.
Kathrin Altwegg 0:20:58
Oder und wir wissen ja nicht ob das direkt von einer super super war dann in einem kleineren stern war und wie es von dort haben,das sind einfach unsere das ist unsere idee,unsere vorfahren sind sind diese stirn kategorien und da haben wir von allen.
Tim Pritlove 0:21:20
Wenn man jetzt diese beobachtung macht also die massen spektrum meter,die jetzt an bord dieses raumsonde waren toto ähnliches kam er dann zum einsatz auch bei der beobachtung des jury kometen ich sag jetzt nicht den ganzen namen bei stolper jedes mal darüber auf rosita,wo also wie lässt sich denn diese beobachtung diese chemische beobachtungnoch machen also ein beispiel haben sie ja schon genannt das einmal teleskop wo es auch vom boden ausgemacht wird an an welchen orten finden sich noch solche analyse methoden mit der man wirklich vom feststellen kann okay was,was ist da draußen und worum handelt es sich konkret.
Kathrin Altwegg 0:22:08
Wenn sie das material sterben haben,dann wird das abkühlen und dann wird's reagieren und moleküle geben das ist dann die astro chemie und die gibt es in an verschiedenen orten sie können das im dunklen wolken beobachten mit radio teleskope,zum beispiel sie können es beobachten dort wo stürme geboren werden,passiert und dann können sie wieder beobachten nach der entstehung der sterns bei der planeten entstehung scheiben,das machen sie alles mit vorwiegend info radio,warum können sie vom boden zum teil können sie es auch nur vom weltall weil unsere atmosphäre das verhindert dass wir das sehen wir sehen uns,und dann können sie natürlich im sonnensystem zu den verschiedenen objekten hinfliegen und das vor ort.
Tim Pritlove 0:23:13
Welche raum gestützten teleskope kommen denn am wesentlichen zum einsatz derzeit.
Kathrin Altwegg 0:23:21
Ich kenne die alten besser hören wein ein hervorragendes,im moment.Aber noch ein bisschen und dann das teleskop sollte oder warten wir jetzt schon ein bisschen oder.
Tim Pritlove 0:23:45
Ja hat sich etwas verzögert.
Kathrin Altwegg 0:23:47
Dass es dann in der lage eis zu analysieren,oder die meisten können nur die personalisieren und nicht die.
Tim Pritlove 0:24:00
Ja da sind alle schon in in ehrfurcht dass wenn dieses teleskop dann wirklich mal gestartet und in betrieb genommen wird dann hat es glaub ich auch so ziemlich alles eine erhebliche auswirkung in der raumfahrt und raum forschung gibt's glaube ich.
Kathrin Altwegg 0:24:14
Das glaube ich schon also wenn wenn es funktioniert dann wäre.
Tim Pritlove 0:24:17
Funktioniert ja das wollen wir doch mal hoffen.Wenn man jetzt mal so zeigen diesen diesen immer währenden zyklus haben wir jetzt quasi immer nur auf sterne und diese diese extrem ereignisse der stern explosion oder fusion,geschaut aber wenn man jetzt sich bilder anschaut,des universums sowie habe das vorzüglich liefert dann gibt's ja nicht nur sehr viele sterne sah es gibt auch diese nebel diese bereiche nebel sind oft einfach auch nur sehr viele sterne aberes gibt ja auch wirklich diese diese bereiche wo sterne überhaupt erstmal entstehen.
Kathrin Altwegg 0:25:01
Oder es gibt eben die dunklen das ist bevor.
Tim Pritlove 0:25:06
Bevor irgendwas ist genau da wollte ich jetzt eigentlich darauf hin so was ist da wo erstmal kein stern,ist also wie muss man sich quasi die die diese beschaffenheit des universums derzeit so vorstellen wenn man sagt immer so ja im weltall da ist ja nichts und totales,wenn dem so wäre gar nichts also irgendwas muss ja irgendwo sein aber war was ist sozusagen,meistens da wo kein stern ist was findet man dort.
Kathrin Altwegg 0:25:37
Also das universum ist natürlich überhaupt nicht leer es hat eigentlich überall wasserstoff.Und medium im dünsten gebiet haben wir immer noch zehn hoch vier teilchen pro kubikmeter,definitiv nicht leer und,wenn es dann ein bisschen dichter wird als irgendwelchen statistischen schwankungen dichte schwankungen dann bilden sich dann eben gerne solche wolken die bestehen aus staub,der staub entsteht wenn ein stern stirbt,fühlt sich das material ab und dann kein stauben stehen also es ist eigentlich auch schon einmal aber ein einmaliger dass bei relativ hohen temperaturen existieren kann zum beispiel.
Tim Pritlove 0:26:28
Kann man davon ausgehen dass er eigentlich,das meiste material schon irgendwie,in moleküle form also in kombination mit anderen atom vorliegt oder ist eigentlich so reines material vorher.
Kathrin Altwegg 0:26:46
Im interesse hat schon relativ viel im,aber es hat eben diesen staub.
Tim Pritlove 0:26:53
Weil es einfach alles kontaminiert ist von vierzehn milliarden jahren explosion okay.
Kathrin Altwegg 0:27:01
Und eben wenn sich diese staub körner zusammenfinden auch wieder durch gravitation gibt das dunkle wolken und die sind extrem kaufen.
Tim Pritlove 0:27:11
Ich kann denn in dieser kälte alles so können können diese ganzen moleküle sich in dieser kälte überhaupt so ohne weiteres bilden wie man das von der erde her kennt.
Kathrin Altwegg 0:27:19
Das ist etwas dass man erst seit kurzem weiss dass das geht,ihnen sagen das geht nicht sie brauchen aktivierung energie,sie brauchen mindestens energie um zu organisieren dann geht's ohne energie barriere,aber man hat gemerkt dass an den oberflächen diese kirmes politische chemie funktionieren.Das heisst sitzt ein atom ab zum beispiel ein sauerstoff sitzt auf diesen staub karten und dann kommt ein wasserstoff,und dann kann das durch den tunnel effekte mechanische tunnel effekte miteinander agieren wirtschaft oberfläche dieses stadt.
Tim Pritlove 0:28:03
Also durch die pure nähe.
Kathrin Altwegg 0:28:04
Und dann haben wir sie dann haben sie schon dann kommt noch ein wasserstoff und dann hatten sie.Und so wird gebildet auf diesen staub,in den dunklen wolken auf die temperaturen das verbieten.Und mittlerweile wissen wir dass das schon relativ komplexe moleküle geben.
Tim Pritlove 0:28:27
Was heißt relativ komplex.
Kathrin Altwegg 0:28:29
In der gastronomie ist ein komplexes moleküle dass mindestens sechs atome hat und ein kohlenstoff das sind komplett gar nicht.
Tim Pritlove 0:28:42
Botschaft muss aber dabei sein.
Kathrin Altwegg 0:28:43
Ein kohlenstoff und fünf andere stoffe mindestens sechs dome und mindestens ein.
Tim Pritlove 0:28:53
Okay das heißt das ist das was da draußen so rum war er sagte sie dadurch statistische verteilung alsound würde jetzt mein ist ja alles gleichmäßig verteilt,aber irgendwann ist es dann halt auch mal zufällig nicht gleichmäßig verteilt in dem moment entsteht so ein ungleichgewicht das wiederum dazu führt dass halt die gravitation sich stärker ausgeprägt als es normalerweise tutund dann die dinge irgendwie zueinander kommen sich gegenseitig anziehen und dann so eine art,sag mal sagen so eine verklumpen sozusagen bewirken dass dieser,mehr oder weniger gleichmäßig verteilt die staub eben nicht mehr so gleichmäßig verteilt ist und das hat er dann so diese kettenreaktion dass wenn erstmal irgendwo was dichter ist dann hat es ja wieder mehr gravitation was dann wiederum andere teile an zieht etcetera,wie geht dieser prozess dann üblicherweise weiter was weiß man darüber.
Kathrin Altwegg 0:29:45
Oder diese wolken können dann im prinzip zu schwer werden also gravitation überwiegt dann und dann können sie kollabieren,und dann bekommen sie gebiete wo sterne stern bildung möglich ist wenn die dichte hoch genug wird dann können sich sterne bildet.
Tim Pritlove 0:30:03
Ist ganz schön schnell von irgendwie da sind so ein paar kleine partikel und dann bildet sich gleich so im stern,es ist ja ist es dann immer ein stern oder muss man quasi so,ist eigentlich eigentlich immer gleich auch automatisch an sternen system was dabei entsteht.
Kathrin Altwegg 0:30:20
Also entstehen meistens viele sterne wenn eine sache sind risiko riesig wenn die kollabieren,wird es an verschiedenen orten dicht genug dass ein stern sich bilden kann das material,und also haben wir am meistens stellenangebote geboten von mehreren sterben und was wir heute wissen meistens bilden sich dann auch die plane.
Tim Pritlove 0:30:45
Und das ist auch eine gute erklärung dafür warum wir so viele doppel sternen.
Kathrin Altwegg 0:30:49
Genau genau.
Tim Pritlove 0:30:49
Thema zum beispiel aussehen also es ist jetzt nicht so die ausnahme man für uns ist das natürlich total mystisch ort zwei sonnen und so aber,kommt relativ oft vor und es ist jetzt auch nicht so überraschend wenn man da mal so drüber nachdenken na ja okay also das wenn sich irgendwo ein sternen bildetdann ist eigentlich auch genug material für weitere dabei die frage ist immer nur reicht's dann aus erinnere mich ja irgendwann,auch mal über den saturn gesprochen der irgendwie auch,sehr groß ist viele monday,hätte auch hätte auch zu 'ner sonne gereicht hat halt ein bisschen was,gefehlt und so ist es dann halt nur ein weiterer planet geworden.
Kathrin Altwegg 0:31:33
Diese dunklen wolken die sind absolut riesig das ist ein vielfaches des sonnensystems an masse.Das ist nicht nur ein kleines gebildet das ist riesig und damit genügend material vorhanden für einen stern oder für viele sterne die neuen gerissen und.Ausstattung natürlich aber so stellt man sich vor dass sterne geboren werden.
Tim Pritlove 0:31:59
Solchen beobachtungen sprechen reden wir da jetzt im wesentlichen von beobachtung in unserer eigenen galaxie oder äh sind wir auch in der lage über die milchstraße hinaus solche beobachtungen zu machen.
Kathrin Altwegg 0:32:10
Ja wir sind ja nicht viele sterne außerhalb unsere milchstraße dann sind wir immer gerade ganze galaxien die sind sehr weit.
Tim Pritlove 0:32:19
Darüber kann man in dem sinne gar nicht solche aussagen treffen das heißt es jetzt.
Kathrin Altwegg 0:32:21
Ja ja aber dann zu nehmen dass das überall passiert.
Tim Pritlove 0:32:25
Aber er kann es nur so inspirieren sozusagen aus dem also wesentlichen der beobachtung traum ist die milchstraße.
Kathrin Altwegg 0:32:30
Genau genau genau.
Tim Pritlove 0:32:30
Für solche betrachtung.
Kathrin Altwegg 0:32:34
Jetzt hat man keinen direkten zugriff.Aber man nimmt an dass kometen eigentlich noch am besten reflektieren was was damals war bevor es sich die sonne gewinnt.
Tim Pritlove 0:32:50
Warum nimmt man das an.
Kathrin Altwegg 0:32:51
Weil kometen die kommentare bis heute hat da weiß man die sind so bei uranus nett und entstanden das ist weit weg von der sonne und sind ja dann hinaus gekriegt worden.Sind seite eigentlich immer da draußen bis sie dann mit einem klick erhalten und reinkommen,die periode zwischen kometen zu ein kurz bei radio tischen oder die kommen natürlich nicht so häufig nicht so viel da kann man schon häufig aber nicht so oft weil die verlieren material,die sind ja nicht grosse vier kilometer ungefähr prozent des materials verloren,das heisst gibt.
Tim Pritlove 0:33:44
Bei null komma eins prozent bei diesem durchlauf an der sonne pro umlauf quasi.
Kathrin Altwegg 0:33:50
Das heißt es gibt.
Tim Pritlove 0:33:52
Schauen sie mal rum und alles ist weg.
Kathrin Altwegg 0:33:53
Ja ja so ungefähr und wahrscheinlich gibt's den vorher nicht mehr weil wir dann thermisch instabil und und bricht auseinander und dann geht's sehr schnell.Warum haben wir eigentlich immer gut tiefgefroren.
Tim Pritlove 0:34:08
Und das erklärt jetzt auch nochmal dieses große interesse,für diese disziplin gerade an kometen weil man einfach weiß das ist halt das material,vermutlich im wesentlichen so wie es war als sich unsere planeten in unserem sonnensystem gebildet haben.
Kathrin Altwegg 0:34:30
Genau genau.Und jetzt die aufgabe von rauszufinden woher stammt das material ursprünglich wieviel vom ursprünglichen material ist übrig geblieben,wie hat es sich verändert bei der bildung des kometen der planet ein system und was was sehen wir eben noch vom ursprünglichen bei diesem mann.
Tim Pritlove 0:34:56
Was war ihre rolle bei bei der rose mission über toto hat man ja schon kurz gesprochen im prinzip nochmal das gleiche in grün oder war das so eine andere ausgabe.
Kathrin Altwegg 0:35:06
Also bei rosinen massen meter das hier in der schweiz gebaut wurde aber mithilfe von deutschland frankreich belgien und den usa,weil ich zuerst mal.
Tim Pritlove 0:35:21
Rosita spektrum meter vor analysis das heißt rosin.
Kathrin Altwegg 0:35:31
Mit dem instrument haben wir auch neutral gemessen millionen sondern vor allem neutral,zuerst projektmanager habe das ganze zusammengebracht oder die vielen interface ist mit unseren kollegen und industrie gemeinsam mit reza,dann mein chef funktioniert zweitausenddrei professor und nachher habe ich die leitung übernommen prinzipiell investor von,verantwortlich für das instrument.
Tim Pritlove 0:36:05
Aber überhaupt sehr viel personelle kontinuität zwischen diesen beiden projekten zwischen toto und rosita.
Kathrin Altwegg 0:36:12
Bei uns ja sonst eben nicht oder nein hat er die meisten leute die bei schotter dabei waren sind ältere und früher als geschieden.
Tim Pritlove 0:36:23
Okay aber dann die nachfolger kam sozusagen.
Kathrin Altwegg 0:36:27
Glücklicherweise damals noch relativ jung und dann hab ich bei der missionen mitgemacht.
Tim Pritlove 0:36:33
Aber viele institute die sozusagen schon bei.
Kathrin Altwegg 0:36:35
Institute schon ja ja ja das sind das sind so plus minus dergleichen.
Tim Pritlove 0:36:43
Okay es war ja die ausbeute bei otto überschaubarna haben wir gerade angerissen so da war noch nicht so viel möglich das war ein kurz,das projekt man hat die gelegenheit ergriffen das ist möglich warspannende geschichte ist ja auch einiges schief gegangendann war ja im prinzip wetter die möglichkeit okay jetzt kann man alles nochmal richtig machen jetzt haben wir schon viel gelernt jetzt wissen wir auch mehr worauf ihr eigentlich schauen wollen und der katalog von dingen die untersucht worden im rahmen dieser mission war jaextrem groß als nochmal diese chemische,cosmos chemische perspektive nehmen mit dem rosine instrument was war,was war das ziel was was wollen sie herausfinden konkret und vor allem was wohl.
Kathrin Altwegg 0:37:33
Also wir hatten natürlich von daher ganz klar sehr viele offene fragen an den kommen,zum beispiel das wasser das wasser des wassers wir haben bei gefunden dass kometen wie,nicht verantwortlich sein können für unser wasser die hat man nicht drüber eingestimmt.
Tim Pritlove 0:37:57
Was hat er da nicht über eingestimmt.
Kathrin Altwegg 0:37:59
Auf der erde haben sie etwa jedes zehntausendsten wassermoleküle ist dekoriert hat ein territorium statt ein wasserstoff ostern und beim kometen dreimal mehr.
Tim Pritlove 0:38:14
Das ist ein eindeutiges indiz dass das nicht die quelle sein.
Kathrin Altwegg 0:38:16
Das genau genau sonst hätten wir hier auf der erde auch mehr.
Tim Pritlove 0:38:20
Aber um das zu verstehen was was kann denn dafür sorgen dass dieser,dorothee anteil anders ist also man würde ja erwarten wenn sich überall alles auf dieselbe art und weise bildet müssen sich ja auch wasser eigentlich überall in ich bin ist das dann quasi etwas was sich später einstellt oder andere.
Kathrin Altwegg 0:38:38
Es ist das ist jetzt wirklich sie bilden wasser raus wasserstoff und sauerstoff es gibt eine reaktion für schlussendlich zu wasser,und bei der chemie haben sie immer auch die rückwärts reaktion,wasser wasserstoff sauerstoff und die reaktionszeit raten wie lange das geht bei welcher temperatur,die ist anders für das als für wasserstoff,und so können sie je nach temperatur wo sie das wasser bilden,mehr im fertigen wasserkraftanlage oder weniger.Im prinzip unser sonnensystem hat sehr wenig leute ihre um das ist nur ein teil in hunderttausend im wasser haben wir,das ist oder weil diese reaktion gut funktioniert dass man das wasser anlage.
Tim Pritlove 0:39:38
Das heißt es ist eigentlich eine eine eigenschaft unseres sonnensystems dass wir diese art und weise von wasser haben mit dieser verteilung dieser art fingerabdruck ist für den ort.
Kathrin Altwegg 0:39:51
Für die physikalischen bedingungen unter der das was gebildet wurde die temperatur formen.
Tim Pritlove 0:39:57
Okay aber das würde er dann bedeuten dass dieser komet von woanders ist.
Kathrin Altwegg 0:40:02
Nein das heraus gebildet wurde.
Tim Pritlove 0:40:05
Also im sinne von.
Kathrin Altwegg 0:40:05
Dort ist ja kalter.
Tim Pritlove 0:40:07
Ok also es geht hier um die bereiche des sonnensystems wo es sich.
Kathrin Altwegg 0:40:09
Genau.
Tim Pritlove 0:40:11
Und die vermutung oder eine der vermutung war ja das wasser auf der erde überhaupt erst später dazu gekommen ist ich freue mich eigentlich auch noch warum auch gleich nochmal diskutieren aber wo kommts her und,ist damit diese theorie der kometen jetzt schon komplett,gestorben oder ist es nur dass die aus der wolke nicht mehr dazu.
Kathrin Altwegg 0:40:32
Wir haben eben bei schotter haben wir das ganz klar gezeigt dass das nicht sein können und dann war natürlich die große frage können bitte familienkarte sein die aus dem gürtel stammen.
Tim Pritlove 0:40:46
Da kommt der touri her.
Kathrin Altwegg 0:40:47
Na ja da kommt aber auch zwei und halb zwei konnte man mit.Vom space ausmessen und der hat ein irdische es verhältnis für das deutsche,und dann und dann hat man gesagt ja jetzt wissen wir es nicht,und dann.
Tim Pritlove 0:41:12
Ich konnte nicht beobachtet werden von herrscher war.
Kathrin Altwegg 0:41:15
Nein nein ja der ist auch klein klein und aktiv.Und dann haben wir das was dann beim zürich gemessen und gesehen dass es noch viel extremen ist aus harry und das definitiv comedy-video können,und was wir ja einfach gesehen haben kometen haben ein breiten bereich wurden wahrscheinlich eben nicht alle am gleichen gebildet.Unabhängig davon was sie sich heute aufhalten.
Tim Pritlove 0:41:49
Das heißt das war eigentlich wie sagt man immer so schön es gibt ja keine es gibt ja keinemisslungenen versuche also was auch immer man man macht man gewinnt immer irgendwelche erkenntnisse mindestens über die eigene technik,wenn sie da mal nicht so funktioniert,das heißt diese frage ist eigentlich nach wie vor unbeantwortet wo das wasser herkommt man kann nur sagen es sind nicht auf jeden fall kometen aus.
Kathrin Altwegg 0:42:17
Wir haben mittlerweile daten von etwa zwölf kilometer,drei sondern etwa zwölf die meisten vom boden geschützten beobachtungen und der mittelwert ist weit über dem wert den wir hier auf der erde haben und damit können wir wahrscheinlich kommentare,die beiden theorien die übrig bleiben eines die haben einen waschen kein um das kompatibel ist mit unserer reihe.Das andere ist dass die erde ihrem wasser selber behalten haben.
Tim Pritlove 0:42:54
Was ja sozusagen immer das war wo ich mich immer gefragt habe,warum muss es denn von woanders kommen vielleicht war es ja schon immer da es ist jetzt so nicht so dass es jetzt nicht es gibt auf den maßen aufm boden überall gibt's wasser warum soll es nicht auf der erde dann auch schon immer wasser in der entsprechende menge gegeben haben.
Kathrin Altwegg 0:43:13
Also was wir halt wissen die erste wahl heißt am anfang zweihundertfünfzig grad celsius da hat es kein wasser oberfläche,und sie hatte ja diesen monat im pakt grosse planet zusammengeschlossen ist und darf entfernt garantiert alles oberflächen.Aber aber nicht unbedingt natürlich das wasser,und es gibt wissenschaftler die behaupten es gäbe sogar einen wasser vom tiefen mantel an die oberfläche und wieder zurück mit einer periode von einer milliarde,so kann man sich erklären vielleicht dass das wasser von unten kommt.
Tim Pritlove 0:44:00
Warum ist man sich so sicher dass das wasser an der oberfläche bei dem zusammenstoß auf jeden fall weg ist ich meine,ja dann im schlimmsten fall immer noch so in dem eigenen orbit um die sonne herum und hätte ja dann.
Kathrin Altwegg 0:44:14
Nein nein einnehmen.
Tim Pritlove 0:44:14
Eingesammelt werden können.
Kathrin Altwegg 0:44:15
Einen pakt der größenordnung von von diesem mond vor allem,montag impakt der muss das was der hat die ganze atmosphäre.
Tim Pritlove 0:44:27
Ja wo ist sie denn dann hin das wird ja nicht.
Kathrin Altwegg 0:44:29
Also das hat garantierte die frucht geschwindigkeit erreicht das material das ist einfach.
Tim Pritlove 0:44:37
Okay also es ist einfach einfach weg.
Kathrin Altwegg 0:44:40
Einfach weg viel oder wir haben an der oberfläche nur.
Tim Pritlove 0:44:48
So ein kleiner tropfen ja das ist immer schön wenn man sich so eine visualisierung anschaut so größe der erde und wie groß wäre jetzt sozusagen die erde wenn sie nur aus dem wasser besteht was sie hat und das ist so ein kleiner tropfen der irgendwie dannist das ist relativ wenig kann man sich dann wiederum ganz gut vorstellen dass du so so eine menge wasser auch im im erdbeeren hätte überleben.
Kathrin Altwegg 0:45:06
Heute wissen wir glaube ich dass das mehr oder weniger kritisch und die haben so zwischen zwei und fünf prozent waffen.Das heißt unsere hätte längst genug das wieder zu bringen.
Tim Pritlove 0:45:25
Das heißt man könnte jetzt so laienhaft sagen okay also man hat sich die kometen die theoretisch selten vorbeibringen können angeschaut da kommt's wahrscheinlich her,die wahrscheinlichkeit dass es einfach innerhalb der erde geschlummert ist und durch diesen aufprall zwar was weggeflogen ist aber dann eben auch sehr viel wiederum von innen freigesetzt wurde das hand und fuß hat haben könnte.
Kathrin Altwegg 0:45:48
Ich bin nicht geologie und von daher bin ich immer vorsichtig aber es leuchtet das möchten wir nicht wahnsinnig ein aus der rede haben hatten sich am anfang viel mehr wasser als heute.Aber wahrscheinlich nicht so viele kommen,und dann brauchen sie einen neuen viele einschläge um das wasser zu bringen und bei jedem einschlag passiert das oder sie bringen zwei material aber sie entfernen auch wieder und wenn sie sehr sehr viele einschläge brauchen dann am schluss entfernen sie mir auf sie bringen.Das ist so aber ich bin auch.
Tim Pritlove 0:46:27
Ja gut aber das klingt ja.
Kathrin Altwegg 0:46:31
Meinen das passt nicht.Aber was schön ist wir wissen auch wie viel kommentare kommen,es ist längst nicht alles aber jetzt jetzt kann man wieder die die vorläufe sterben die atome machen,die machen je nach ob es eine super oder ein kilo machen die verschiedene so toben verhältnisse,das sind das sind atome die haben die gleichen chemischen eigenschaften die gleichen anfang proton verschiedene drohnen.
Tim Pritlove 0:47:19
Das heißt daraus ergibt sich 'ne andere masse aber kein anderes chemisches.
Kathrin Altwegg 0:47:22
Genau verhalten richtig.
Tim Pritlove 0:47:25
Deswegen ist halt auch wasser mit dem interior ist verhält sich immer noch wie ein normales wasser aber man kann's quasi wiegen und stellt fest ist schwerer.
Kathrin Altwegg 0:47:33
Jetzt bei den das macht keine chemie.Das hat das kommt den neuen varianten vor vom masse hundertvierundzwanzig bis hundertsechzig,und die menge jedes tops dies das ist dein fingerabdruck woher es kommt,da kommt ein teil kommt von super koalitionen sterben wir unsere sonne das kommt von frau herkommen aber die verteilung diese über die maßen,ist je nach vorläufer stern verschiedene.
Tim Pritlove 0:48:16
Das geht jetzt nur funktionieren oder es geht generell für alle.
Kathrin Altwegg 0:48:19
Das ist einfach gut weil es neun hat oder viele haben null eins zwei.
Tim Pritlove 0:48:26
Ja das viel varianz drin.
Kathrin Altwegg 0:48:28
Genau kann man viel variante dann kann man ein bisschen unterscheiden und das komische bei unserer erde ist dass in unseren atmosphäre das gesehen und nicht dem gesehen ohne mindern.Der fingerabdruck.Das ist nicht solar- entspricht nicht sonne entspricht nicht,sondern es anders und seit vierzig jahren mehr als vierzig jahren hat man versucht zu finden wieso das in unserer atmosphäre.
Tim Pritlove 0:49:07
Welches kino ist es denn mit wieviel.
Kathrin Altwegg 0:49:09
Eine mischung von vorläufer einen ganz kleinen fingerabdruck,und seit dem messungen von rosinen wissen wir,dass es kompatibel ist mit ungefähr zweiundzwanzig prozent sendung vom kometen,wenn sie das mischen da kriegen sie exakt dem fingerabdruck,atmosphärisch.
Tim Pritlove 0:49:38
Nochmal wenn ich was mische das.
Kathrin Altwegg 0:49:39
Zweiundzwanzig prozent kommt mit achtundsiebzig prozent genau.
Tim Pritlove 0:49:44
Er hat inneres ergibt unsere atmosphäre was wiederum dafür sprechen könnte dass so ein komet auf der erde eingeschlagen ist und sich dadurch gemischt hat.
Kathrin Altwegg 0:49:55
Also das heisst wahrscheinlich dass komedien eingeschlagen habe oder längst nicht so viel dass das das wasser.Und man kann dann aber gesehen und.
Tim Pritlove 0:50:04
Vielleicht.
Kathrin Altwegg 0:50:07
Dann kann man ausrechnen wieviele kometen brauchen sie um das zu bringen und wie viel wasser bringen die gleichzeitig oder mit einem gesehen und wir wissen ja wie viel wasser,es hat dem kommen,und dann können sie ausrechnen und dann kommen sie zum schluss das vielleicht ein promille bis maximum ein prozent der serbischen was,wenn sie zweiundzwanzig prozent des gesehen uns liefern.
Tim Pritlove 0:50:30
Ja ja.
Kathrin Altwegg 0:50:35
Und damit können sie nachher ausrechnen wie viel organische materialien die kometen gebracht haben zu der zeit weil wir wissen wie viele organische material wir im kometen haben relativ zum gesehen und,und dann kommen sie darauf dass mehrfach die heutige biomasse von kometen geliefert.
Tim Pritlove 0:50:57
Das heißt das ganze ist eigentlich so 'ne art detektiv,was da so rum kreucht und fleucht und eben nicht nur welche elemente an sich,dort vorhanden sind sondern eben auch konkret in welcher ausprägung welcher mischung all diese ganzen,regung und versucht das alles in relation,auf anderen himmelskörper in beobachtung et cetera hat,puh das ist ja relativ komplex aber dann nochmal kurz auf die ergebnisse von dem rosinen instrument also bei der rosita mission schauen,wie komplex ist denn der komet letztlich rein chemisch ist da sehr viel mehr gefunden worden als man dachte weniger.
Kathrin Altwegg 0:51:50
Nein nein es ist extrem komplex form haben wir eben sehr viel organische materialien gefunden wir haben zum beispiel so lange kohlenstoff ketten gefunden bis zu,sieben acht kohlenstoff wir haben ein euro magische moleküle gefunden als pensionen auf berlin das sind dringend,wir haben alkohol gefunden besser,kohlenstoff vertonen verschiedene alkohol.
Tim Pritlove 0:52:19
Es gibt alkohol auf.
Kathrin Altwegg 0:52:21
Ja es gibt auch ethanol also den rest würden sie lieber nicht trinken aber er hat's aber haben sehr früh herausgefunden dass der comic stinkt.
Tim Pritlove 0:52:32
Also müsste wenn man ihn hier parken würde dann würde stinken.
Kathrin Altwegg 0:52:36
Und zwar schrecklich das nachgestellt das stinkt wirklich es hat.
Tim Pritlove 0:52:46
Ach wir haben sozusagen dass all das was man sozusagen in der zusammensetzung vorgefunden hat einfach mal gemischt und mal geguckt was da sozusagen.
Kathrin Altwegg 0:52:51
Gemischt ja ja ein kollege von uns hat das in england dann auf postkarten ein verbleibt oder das kann man so.
Tim Pritlove 0:53:00
Ach so dass man diese ein duftet oder.
Kathrin Altwegg 0:53:02
Genau dass man die einen dürften und ich kann ihnen sagen kiste bekommen die ist bei mir im büro gestanden aber nicht lange.
Tim Pritlove 0:53:11
Okay.
Kathrin Altwegg 0:53:13
Das stinkt wird oder es hat das recht,alle möglichen dinge die stinken es hat sehr viel schwefel haltigen dinge die andere stinken.
Tim Pritlove 0:53:32
Ist es nur unangenehm oder ist es auch giftig in dem sinne für uns.
Kathrin Altwegg 0:53:37
Es wäre giftig wenn es in genügenden konzentration wäre aber die konzentration in der atmosphäre des kompetent ist klein oder das sind nicht überleben sie schon.
Tim Pritlove 0:53:49
Das heißt das stinken ist eigentlich eher auch eine reaktion unseres körpers dass er merkt so,wenn du davon zu viel nimmst ist nicht gut für dich okay gut ne das ist ja auch keine schlechte reaktion.
Kathrin Altwegg 0:53:56
Genau richtig ja naja aber so ein bisschen der höhepunkt von komplexität war dann die aminosäuren sind wir haben minus gefunden auf dem kommen.Kein leben definitiv nicht alles viel zu kalt auf den kometen aber die tatsache dass aminosäure entsteht ohne zutun eine ohne zu tun sonnensystems ist schon sehr bedeutungsvoll.Und so kann es sein dass komedie neben mit dem gesehen und ein bisschen wasser.Diese organische moleküle gebracht haben auf die erde und dass das vielleicht eine auslöser war dass sich leben.

Tim Pritlove 0:54:43
Aminosäuren sind ja wenn ich das richtig verstehe die die basis der proteine und die proteine sind sozusagen die basis von so ziemlich alles was in unserem körper so,abgeht so also ohne proteine läuft da mal überhaupt nix und spricht man kann sagen in dem moment wo sich aminosäuren irgendwo bilden ist eine grundlage geschaffen um,theoretisch ein leben so wie wir es jetzt definieren als leben ja das hat quasi unsere menschliche manuel jede sicht der dinge,kann durchaus sein dass auch noch andere varianten gibt nur kennen wir die eben nicht dass sie damit sozusagen geschaffen ist,sprich wenn schon auf einem kometen der eigentlich die ganze zeit nur im kältesten regionen wo man nicht passiert ja also es ist ja quasi wirklich das absolute dorf da draußen,wenn sich dort im prinzip schon alles bilden kann was es braucht,ist das alles was man braucht also fehlt auch noch irgendwas essentielles was hat man da irgendwas nicht gefunden von dem man sagt so also wenn er wenn das nicht dabei ist dann läuft das alles nicht.
Kathrin Altwegg 0:55:51
Nein wir haben auch zum beispiel hat man zum ersten mal gefunden hat ist ebenfalls absoluten lebensnotwendig von unser körper wird es nicht funktionieren hat man auch beim kometen gefunden wir haben,das ist jetzt vielleicht der nachteil unserer forschung,wir haben ganz viele male kühle gefunden die als sogenannte biomarkt gelten als zeichen dass es dort leben haben,herzhaften comedian aber kein leben ich sag's nochmal leben aber die biomarkt sind dort,das heißt wenn sie jetzt einen planeten außerhalb unseres sonnensystems anschauen und sie sehen diese moleküle sagt ihnen das überhaupt nicht dass es dort leben,es wird dank der forschung wird es viel schwieriger werden eindeutig sagen zu können auf diesem planeten hat's leben.
Tim Pritlove 0:56:46
Aber wenn wir jetzt den kometen so nehmen würde man würde eine dicke heiz lampe einfach darüber halten also wenn das sozusagen das einzige problem ist würde sich dann zwangsläufig da etwas entwickeln oder.
Kathrin Altwegg 0:56:58
Das ist schwierig zu sagen also,meiner meinung nach wenn sie den kometen ins meer werfen dann schmilzt er die moleküle werden beweglich sie können reagieren mit dem flüssigen wasser,und aber beim mehr wird sich das sehr schnell verdünnen dass es bekommen keine großen konzentrationen oder nur für sehr kurze zeit,aber wenn sie den kometen entweder in einer,kleineren tempo werfen tun hier bei bayern dann können sie sehr schnell eine hohe konzentration an organische moleküle erzeugen,und das kann dann mit dem wasser flüssig wasser und mit den mineralien die es auch braucht,reagieren und so eventuell zu leben führen es gibt gibt der wissenschaftler die schreiben über kometen tempo,ein großes meer wahrscheinlich eher kleinere tümpel also die kometen selber bringt wasser mit vielleicht reicht auch schon aber es braucht wahrscheinlich in kontakt zu treten,mineralien.
Tim Pritlove 0:58:09
Die jetzt auf dem kopf so nicht fahren.
Kathrin Altwegg 0:58:12
Ja es hat schon mineralien.Und die idee ist ein bisschen dass eben nicht nur reinkommen eingeschlagen hat vielleicht hunderttausend so,und dass sich leben an verschiedensten leuten kommen zu entwickeln und das meiste war für mich oder ist gerade wieder ausgestorben eines hat sich durchgesetzt und da müsst ihr das leben auf dreht,ist alles gleich in der gleichen.
Tim Pritlove 0:58:46
Es gab doch mal dieses schöne experiment mit der suppe wo im prinzip eigentlich nur so ein,ich weiß nicht ganz genau was drin war wasser mit irgendwelchen elementen einfach nur der strahlung ausgesetzt wurde und sich dann dort eigentlich auch alles gebildet hat was man braucht.
Kathrin Altwegg 0:59:06
Ja ich meine aber das ist genau das was beim kometen auch passiert ist eben in dieser.
Tim Pritlove 0:59:11
Aber der bräuchte es ja noch nicht mal trotzdem noch nicht mal den kometen.
Kathrin Altwegg 0:59:14
Ja aber wir machen es auf der karte also sie brauchen sich mal schon wasser.
Tim Pritlove 0:59:20
Ja aber ja festgestellt ist äh quasi in im schwamm einmal kurz ausgedrückt worden und dann waren die teiche voll so dann kommt die strahlung und haut da mal ordentlich drauf alle anderen materialien sind ja vorhanden.
Kathrin Altwegg 0:59:35
Nee nicht wirklich im wasser.
Tim Pritlove 0:59:36
Kann es sich einfach aus sicht.
Kathrin Altwegg 0:59:39
Nein also es gibt eine andere theorie leben entwickelt hat den kometen ist dass es so voll kanarische,aktivität ist im meer das gibts oder wir wissen es gibt diese unterwasser und dort kommen die richtigen dinge raus.Aber ich glaube das problem dort ist auch sie kriegen die konzentration nicht hin weil es mir nicht stetig oder das bewegt sich das zeug,in relativ kurz.
Tim Pritlove 1:00:12
Ja gut aber es kann ja auch ein vulkan unter einem see gewesen sein wo sich eben nicht so extrem könnte.
Kathrin Altwegg 1:00:17
Könnte er könnte ja ich glaube da ist das letzte wort nicht gesprochen.
Tim Pritlove 1:00:22
Spekulieren herum aber darum geht's ja im prinzip nicht diese ganzen theorien überhaupt erstmal aufzustellen auch einfach um etwas zu haben mit dem man spielen kann so mit was was was wollen wir denn jetzt sozusagen als nächstes eigentlich beantwortet bekommen.
Kathrin Altwegg 1:00:35
Oder meine theorie von entweder kometen im meer das war schon vorhanden und jetzt mit der seite da haben wir eigentlich viele argumente die schon für kometen sprechen,ganz einfach weil es die komplexen moleküle gibt die gibt's nicht beim volk die müssen sie zuerst machen.
Tim Pritlove 1:00:59
Das heißt es ist sozusagen so 'ne art ausgelagert des entstehung labor weil dann komischer,die prozesse sehr viel effizienter ablaufen können oder konzentrierter ablaufen können oder mehr zeit haben.
Kathrin Altwegg 1:01:15
Sie haben mehr zeit.
Tim Pritlove 1:01:16
Einfach mehr zeit ohne dass ich alles die ganze zeit ändert.
Kathrin Altwegg 1:01:16
Ja ja genau genau ja ja sie haben lange lange zeit haben sie die gleichen konditionen.

Tim Pritlove 1:01:25
So ein bisschen so die die petry schale im alter,kurve und wo sich das alles so ein bisschen entwickeln kann und dann fällt es halt irgendwann auf die erde drauf und beschleunigt,diesen prozess oder setzt ihr überhaupt erstmalig in gang was auch eine interessante das fiktive darauf.Vielleicht nochmal ganz kurz,diese frage nach dem leben also ich habe das gefühl diese ganze hatten ja schon erwähnt astro chemie ist im prinzip eigentlich erstmal so entdeckt worden so grade in den letztenzehn zwanzig jahren hört man mehr davon und tut sich auch universitären mir das auch entsprechende institute und spezialisierte studien,gänge gibt es gab auch schon so die eine oder andere aufregung da gab's mal diese etwas schief gelaufen der nasa veröffentlichung wenn ich mich richtig erinnere wo,eine neue form des lebens angeblich gefunden worden sein stellte sich aber raus das war aus welchen gründen auch immer eine ente,diese unsere sicht des,das dessen was leben ist meine das ist ja schon erwähnt und unsere selbstwahrnehmung wie wir wissen ja was leben ist weil wir definieren das was was was wir sind als leben,und die frage ist ja kann es auch,die nicht unsere form des lebens ist also diese variante hat sich halt auf der erde so durchgesetzt aber das heißt ja nicht unbedingt dass es nicht auf anderen planeten auch anders sein könnte sind wir überhaupt in der lage sowas zu entdecken bevor es anfängt und zu sprechen.
Kathrin Altwegg 1:03:06
Was ist eine gute frage oder im prinzip als unser leben ist auf kohlenstoff passiert und braucht flüssig wasser.Was ich mein wasser ist ein ganz spezieller stoff also auch chemisch gesehen hat dann moment und verhält sich dann wirklich anders als die meisten anderen moleküle,und die gibt es nicht wie sand am meer speziell wasser wasser,ist zentral das glaube ich schon hingegen kohlenstoff sie könnten auch sie nehmen ist auch fertig chemisch gesehen,man könnte sich das vorstellen es gibt wahrscheinlich andere möglichkeiten die frage ist halt nur wenn wir das zulassen,wir suchen wir nachdem wir suchen wir noch etwas von dem ihr überhaupt keine ahnung haben wir's aussieht,das ist wahrscheinlich ziemlich hoffnungslos also die philosophen sagen es weiter seine neue spannende frage wie sucht man etwas von dem man nicht weiß.

Tim Pritlove 1:04:20
Das mag sein aber um vielleicht bei den den gedanken also wissen durchzuspielen auch selber mal noch ein bisschen besser zu verstehen,was wir denn jetzt eigentlich quasi,was eigentlich so das besondere ist dieser lebens entstehung also klar wasser und kohlenstoff ist so die basis fall mehr oder weniger alles was quasi bei uns relevant ist,sind verbindungen davon ist das richtig obwohl natürlich bestimmte elemente auch präsent sein müssen um,wie entsprechende prozesse überhaupt in gegangen zu erhalten fußball hat mir schon,erwähnt eisen et cetera also ganzen müssen präsent sein aber sie nicht unbedingt teil,moleküle wählt aus der sich das macht und der pfad geht dann zu diesem aminosäuren die dann die proteine bilden,die sind eigentlich so im wesentlichen der der schlüssel weil diese.Bremen komplexen moleküle verbindung,alles mögliche erschließen im wahrsten sinne des wortes weil sie sind der schlüssel für alle prozesse die in unserem körper abgeben das heißt,was wir eigentlich suchen ist eine kombination von von elementen die sich chemisch zusammen tun kann aber dir auch diesen wunderbaren part einschlagen kann so ein komplexes regelwerk aus sich selbst heraus zu entwickeln,können wir auch sagen dann simulieren wir das mal,durch aber das ist wahrscheinlich schwierig weil einfach die kombination zu zu groß sind aber gibt's denn zumindest andere bereiche wo man so erste schritte schon gesehen hat dass man schon sieht okay es gab hier,das mag sich chemisch alles auch sehr gerne hat aber jetzt nichts mit wasser und kohlenstoff primär zu tun weil es zumindest eins davon weg und hat auch irgendwie so eine gewisse komplexität auch wenn sie noch nicht anfängt zu zucken und zu laufen.
Kathrin Altwegg 1:06:19
Es gibt also meine definiert man leben oder ein,dass man sich produziert und es gibt mineralien die reproduzieren.Reproduzieren und trotzdem ist es nicht leben oder also so einzelne notwendige konditionen verleben die findet man schon man findet einfach die kombination.Auch für unser leben und wir haben noch keine hinreichende definitionen gefunden für uns.Wir wissen wir müssen energie umsatz machen wir müssen reproduzieren und so weiter aber das alles reichen noch nicht am leben zu definieren es gibt keine definition verliebt.
Tim Pritlove 1:07:13
Da so eine sichtweise.
Kathrin Altwegg 1:07:14
Es gibt so eine sichtweise eben wir haben das haben wir mit den theologen herstellen,mit dem philosophen für mich war noch das beste der philosoph der gesagt hat leben ist ein konzept,dass wir kennen an den auswirkungen des hat,in der physik kann man viele konzepte oder zum beispiel kraft der begriff kraft das ist auch ein konzept das merkt man wenn die ausgeübt wird dann merkt man aber im prinzip ein begriff der nicht.Das leben ist auch ein besseren so wir merken überall wo leben ist an den auswirkungen des haben.Aber das es fehlt das stimmt auch nicht.Darum wenn wir unser leben manchmal richtig definieren können wie können wir das,wird vielleicht kommen.
Tim Pritlove 1:08:08
Ich will jetzt mal auf dem ganzen,leben nicht so sehr rum reiten aber vielleicht schauen wir mal sowas an erkenntnissen,gekommen ist jetzt gar nicht mal durch die beobachtung von wolken oder eben kometen sondern unserer unmittelbaren nachbarn die welt schon beobachtet haben also wo wir konkret auch vor ort waren sprich mond,und maß so wie ich das mitbekommen habe ist auch die komplexität auf dem maß sehr viel umfangreicher als man sich das vielleicht vorher so,erhofft hat wir haben ja jetzt dort nicht nur die fern beobachtung,sondern eben mittlerweile auch so labore die herumfahren können und sogar in der lage sind selfies von sich zu schießen weil sie auch schon einen interessanten vorstoß der menschheit finde.Was hat das beigetragen zu der astro chemischen,forschung was sind eigentlich die fragestellung die sich jetzt insgesamt gerade aufdrängen die man beantwortet haben wir jetzt mal auch von dieser lebens.
Kathrin Altwegg 1:09:18
Es ist noch ein bisschen schwierig oder wie sieht man ja eigentlich nur die oberfläche.Und alles andere als privat das ist entwicklungsgeschichte aber anhand von mais und mund kann man eben die entwicklung des sonnensystems nicht unbedingt die bildung die entwicklung studieren.Aber aber wie ursprünglich war wissen und werden wir auch nicht so einfach finden es sei denn wir könnten wirklich auch runter bohren und zwar relativ.
Tim Pritlove 1:09:55
Und wir gerade gesehen haben bei dem zuletzt gescheiterten experiment bohren ist greife einfach.
Kathrin Altwegg 1:10:02
Mein bohren ist gar nicht so einfach.
Tim Pritlove 1:10:04
Zumindest da wo es versucht wurde war es nicht so so einfach.
Kathrin Altwegg 1:10:06
Ja ja ja ja genau.Aber aber die entwicklung zu sehen oder ob man jetzt noch etwas vom ursprünglichen findet.Eventuell spuren noch eines ursprünglichen lebens dort sind da kann man sich noch mehr machen.
Tim Pritlove 1:10:27
Ja gut.
Kathrin Altwegg 1:10:28
Aber es ist eine andere frage.
Tim Pritlove 1:10:29
Ja genau aber ich meine ich verstehe die suche nach dem ursprung und so aber ich meine auch wenn man sich die entwicklung anschaut was,was kann man da auch irgendwas also wie ist die erkenntnis lage,dort also ist das jetzt einfach langweilig weil es halt nur staub und alles schon so geröstet und.
Kathrin Altwegg 1:10:48
Nein nein nein nein etwas wie er dann auch mal sehen wird.
Tim Pritlove 1:10:55
Irgendwann wenn wir sie auch final außerhalb balance gebracht haben.
Kathrin Altwegg 1:11:00
Wenn unsere sonne feststellen wird auch die die biologie verschwinden und dann,sind wir ein bisschen bei maus was übrig bleibt ist auch ein blick kein fenster in die zukunft ist ein fenster wie es auf anderen planeten aussehen könnte wenn wir planeten studierenden,für mich auch wichtig zu sehen wie wir speziell eigentlich die nehmen wir eben die anderen planeten,wir haben hier wirklich einmalige bedingungen und an auch wenn das universum groß ist es wird nicht unendlich viele erben geben,oder weil die bedingungen hier ist im moment absolut einmal.
Tim Pritlove 1:11:48
Ja und vor allem ist auch absehbar das selbst wenn es irgendwo bessere bedingungen gäbe nicht so richtig die technologie haben um dort dann langfristig runterzukommen und ich glaube überhaupt meine das klingt jetzt auch aus unserem gespräch wieder deutlich heraus,dann habe ich mal darüber nachgedacht wir machen uns glaube ich auch zu wenig klar dass wir ja selbst,ein stück dieser erde sind diese wahrnehmung des wir hier so,leben und wir können jetzt mal so wie im salz fältchen auch mal irgendwo anders leben,ja da muss ja nur das fotos vor irgendwo fehlen oder nicht mehr entsprechende menge vorhanden sein dann haben wir da schon ein problem also genau diese spezifische zusammensetzung wie sie sich eben hier gefunden hat hat uns ja überhaupt erst,hervorgebracht und wir sind ja nicht,getrennt davon zu sehen also unser leben ist ja nicht ohne die erde also funktionieren ja im prinzip nur genauso auf dieser erde weil wir,dafür quasi maßgeschneidert sind.
Kathrin Altwegg 1:12:50
Da gebe ich ihnen völlig recht das sage ich auch immer der mensch ist für dich gemacht und kann eigentlich nirgends existieren,neben dem das schon die physik und sagt dass wir nicht ineinander sonnensystem fliegen können in unseren achtzig jahren lebensdauer die wir haben oder.
Tim Pritlove 1:13:10
Aber die chemie macht es einfach komplett und sagst das ist die einzige steckdose indem du dich reinsteckt.
Kathrin Altwegg 1:13:15
Genau ganz genau.

Tim Pritlove 1:13:22
Jetzt gibt es aber auch noch ein paar,ich habe da so ein paar andere lieblinge in unserem sonnensystem die ja sagen wir mal so aus als chemische perspektive finde ich auch super interessant sind,mal äh mal meine super lieblinge sind einerseits der titan also einen der größten mond des saturn und dann installation aus.Jupiter oder toren außer tor ne ja also ich liebe den saturn und seine monde,titan ein kalter mond der,aussieht wie die erde wie wir jetzt wissen nachdem,die äh casino mission sich das ja mal genauer angeschaut hat heute ins also die lander mission der fotos geschickt hat,es gibt alles was ja auch gibt sehen flüsse teller delta,tolles programm besteht aber aus etwas komplett anderem steht aus metall ammoniak all das was stinkt so trotzdem,entfaltet es irgendwie dieselbe ideologische wunderwelt und dann so auf der anderen seite so insel atos und ein teil was um die ganze zeit riesige wasser fontänen ins weltall jagd,was kann man beobachten aus der ferne und durch diese mission und vielleicht gibt's auch andere beispiele aber,haben hat die beobachtung dieser objekte uns nennenswerte daten geliefert die so im chemischen bereich neue aha-momente erzeugt haben.
Kathrin Altwegg 1:15:00
Also sicher die wasserstoff welt von titan.Niemand so vorgestellt dass es diese moleküle hat dass es viele von diesen moleküle hat,die meere machen können sehen machen können eis machen können.Und das zeigt eben dass diese auch wieder wahrscheinlich dass diese moleküle vorhanden waren bei der entstehung von diesem titan und nicht nachher geformt wollten.Dass die eltern ist dass unser sohn,die meisten vom vorher stamm.Lustig weil diese energie muss ja irgendwo herkommen.Und die kommt wahrscheinlich kneten.
Tim Pritlove 1:16:00
Wieso mit mit wasser gefüllt der luftballon mit kleinen löcher der aber gedrückt wird sozusagen.
Kathrin Altwegg 1:16:03
Genau ist ja ja genau meine zeiten kräfte wie es hier vom,und dass das wasser in den flüssig sein kann bei diesen temperaturen die außen herrschen oder sagt auch einiges eben über die energie die von planeten zum zum mund,übertragen werden und das ist physikalisch extrem spannend oder,wie kann man so viele energie dass das wasser flüssig flüssig rauskommt erzeugen dort draußen.
Tim Pritlove 1:16:37
Aber das rätsel was ich da jetzt automatisch im kopf kriege ist wie kann es denn bitte sein,dass wenn jetzt unser sonnensystem sich mehr oder weniger aus demselben sternen gemisch sternen staub gemisch entstanden ist,also der max der varianten drin geben aber das jetzt so extrem sind das jetzt ausgerechnet bei dem titan der sich im saturn drehtalles auf einmal mit irgendwie metall am start ist und gefühlt ein paar meter weiter hat man ein komplett anderen mond körper,ganz andere verteilung aufweist ist wie kann sich denn das soheraus separieren ist da irgendwie die chemie schon von vornherein so gelagert dass ich in in diesem wolken,war sie gleich und gleich gerne gesellt und dann sozusagen erstmal so einen kleinen himmelskörper für sich macht oder hat sich das dann auf dem saturn irgendwie zusammen geballt und es dann durch irgendetwas heraus geschossen wordenwas kann man.

Kathrin Altwegg 1:17:40
Meiner meinung nach spielverlauf,bildung eine rolle und wahrscheinlich ist servus und die dann nicht am selben ort entstanden.Möglicherweise sind beide eingefangen worden vom.Es kann auch sein dass einer mit dem satt und zusammen entstanden ist ich weiß die neueste forschung nicht,verfolgt aber die sind ziemlich sicher am gleichen ort entstanden und haben auch nicht die gleiche größe und größe spielt auch keine rolle der marsch auch relativ nahe beieinander,und trotzdem völlig verschiedene noch einmal ganz anders,also die distanz sonne die distanz zu ihrem grossen,planeten bei den mond die spielt eine ganz große runde,und das sonnensystem der personal nebel war relativ homogen am anfang.Aber innen was mehrere tausend grad warm oder außen was dreißig kelvin oder zehn kelvin,da geht die post an meiner bleibt als eis das ist was mir bei kometen sehen,während im inneren des sonnensystems die moleküle die vom vorher kommen alle in die einzelteile zerlegt wurden bevor sie wieder zusammen.Also das ist einfach die distanz zum stern die das wahrscheinlich hauptsächlich.
Tim Pritlove 1:19:13
Das heißt es ist im wesentlichen tatsächlich erstmal die temperatur die bei der.
Kathrin Altwegg 1:19:17
Temperaturen dichter dichter dichter die bestimmen die sonne ist es extrem heister werden keine komplexen moleküle überleben oder die.Die einzelteile zerlegt auch das wasser wird wahrscheinlich mehrheitlich in bevor er sich dann wieder vor allem.
Tim Pritlove 1:19:43
Das heißt wenn dinge unendlich sind dann weiß es eher darauf hin dass sie mal woanders waren.
Kathrin Altwegg 1:19:51
Genau ganz genau.
Tim Pritlove 1:19:52
Wirklich so viele unterschiedliche monde um saturn herum kreisen zeigt es mir von der masse der saturn der in der lage ist sich irgendwas einzufangen was vielleicht noch nicht mal aus denselben staub scheibe heraus entstanden ist danach sein.
Kathrin Altwegg 1:20:07
Könnte prinzipiell sein aber die relativ geschwindigkeiten sind dann meistens so groß dass die bei fliegen die kann man nicht so einfach einfahren.
Tim Pritlove 1:20:15
Okay das muss dann schon größere.
Kathrin Altwegg 1:20:17
Aber wir wissen dass planeten migriert sind oder gewandert sind im frieden sonnensystem die haben verschiedene,von der sonne weg durchlaufen und je nachdem wo sie den mund geklaut haben oder,also es gibt jetzt dann eine japanische mission mix zu verpassen von mais und dort will man rausfinden oder wurden die akquiriert also bis später,irgendwoher angefangen oder wurden die mit uns zusammen gebildet das ist so die erste stufe die,man muss rausfinden sind die man dort gewesen hätte oder mehr.
Tim Pritlove 1:21:03
Und da ist dann wiederum die cosmo chemie auch der schlüssel weil in dem moment wo man sich das genau anschaut dann.
Kathrin Altwegg 1:21:07
Richtig zahlt dann weiss man unter welchen bedingungen diese mond entstanden sein muss und ob das kompatibel mit.
Tim Pritlove 1:21:22
Was sind denn jetzt so die aktuellen neuen,fragen die sich jetzt in diesem noch relativ jung feld herausgestellt haben,also wenn es vor zwanzig jahren noch so ein bisschen verkannt das gebiet war müssen wir nun mittlerweile so an dem punkt,angekommen sein wo es im prinzip so einen so einen großen katalog gibt auch mal jenseits jetzt dieser rein,lebens frage worauf liegt der fokus und worauf,auch der fokus neuer mission die jetzt in diesem bereich hilfreich sein soll.
Kathrin Altwegg 1:21:59
Ich glaube für die boden gestützte astronomie die haben noch nie.Die es ist einfach ein neues medium zu analysieren als die protokolle da entscheiden wegen vielen stark dann sieht man es nicht mehr richtig.
Tim Pritlove 1:22:24
Also mit brutto planetarium scheiben meinen wir das was letzten endes einen planeten formt oder alle planen.
Kathrin Altwegg 1:22:29
Alle planeten also bei der scheibe hat sich der stern schon zum teil gebildet.Planeten sind am bilden oder die chemie verstehen wir noch nicht was was eben was jetzt dort wirklich abgeht oder was beim position von einem saturn abgeht position von,dieser chemie müsste man studieren können und das kann man noch nicht nehme anders wird immer besser.
Tim Pritlove 1:22:59
Weil man einfach nicht so viele beobachtungen hat aus dem man.
Kathrin Altwegg 1:23:02
Ja mein mann hat so nein aber schwierig zu beobachten weil sie sehr viel staub haben und das macht ihr ein signal nicht gerade freude oder dann gehen die einzelnen linien der verschiedenen moleküle gehen,in diesem sogenannten background.

Tim Pritlove 1:23:20
Das heißt in dem moment wo sich ein sonnensystem bildet,davon reden wir ja jetzt ja beim also sagen so eine größere gruppe und wir waren ja vorhin schon bei der entstehung der sonne und diese sonne gibt es und diese sonne ist dann zwangsläufig von dieser,staub scheibe umgeben aus der sich dann planeten herausbilden und das haben wir ja schon gesehen,es gibt halt natürlich erstmal die ganzen physikalischen unterschiede temperatur dich,und natürlich alles was damit zusammenhängt also die anziehungskraft gravitation der einzelnen teilchen das aneinander reiben und das verklumpen also alles was physikalisch ab,aber das ganze hat dann quasi auch noch einechemische begleiten musik die natürlich durch diese ganzen parameter beeinflusst wird vor allem die temperatur und die dann eben unter umständen auch eine rolle spielen kann oder auf jeden fall spieltwas letzten endes hier ausgelost wird welche welche planeten sichern was sind denn das für chemische,vorgänge die an der stelle auch so auf so 'ner skala überhaupt eine rolle spielen kann ist das dann irgendwie so so ein bisschen,die komische kleid creme die dann sozusagen dazu führt dass irgendwas zueinander kommt.
Kathrin Altwegg 1:24:36
Es kommt drauf an wo sie sich befinden in dieser scheibe,die sogenannte mit plänen also die mittlere ebene ist dunkel haben sie fast kein zufall,und damit wir nicht sehr wahrscheinlich aber wenn sie dann weiter drinnen sind haben sie vier temperatur das wird dann schon besser dann kann ich sie wieder machen,und dann haben sie alle die dynamik dieser scheibe ist ja nicht stationär die bewegt sich und es geht material nach innen und nachher rausgeworfen vom stern,und all diese vorgänge verstehen wir noch relativ schlecht also wie sich das sonnensystem dann wirklich bildet,und was abgeht und eben welche art planet sich weiterbilden kann,man hat immer gesagt das sonnensystem das musste so kommen oder ihnen die drei kleinen planeten,und dann muss er sein.
Tim Pritlove 1:25:38
Dann hat man woanders hingeschaut festgestellt ist.
Kathrin Altwegg 1:25:39
Dann war war gerade neben dem stern war ein riesen planet.Planet das war ein riesen planen,direkt neben seinem stern miteinander zwei oder drei oder vier tage.
Tim Pritlove 1:25:53
Und ein gas planet.
Kathrin Altwegg 1:25:54
Planet gar nicht sein laut allen modellen,heute hat man sehr viele gefunden dass die großen planeten innen sind und nicht um das zu verstehen dass kann man unter anderem mit der chemie tun.Indem spezifisch ist für den nordwest.
Tim Pritlove 1:26:16
Ja ich wollte mich gerade fragen okay,woran kann man jetzt dieses modell verbessern das bedeutet die planeten forschung,weil auch schon mal besprochen haben ist da eigentlich auch ein einer der schlüssel,indem man sich möglichst viele andere sonnensystem immer besser anschaut also erstmal,planeten entdeckt aber gibt es verschiedenste methoden die funktionieren relativ gut jetzt gerade leider käppeler außer betrieb gegangen aber andere,andere teleskop mission sind in planung also das wird auf jeden fall wieder 'ne beschleunigung bekommen und man hat ja auch gesehen nachdem man die ersten methoden,entwickelt hatte es ging ein ziemlich ab also man hat ja,so eine extrem starken anstieg an entdeckung gehabt und ich weiß gar nicht wie viele sonnensystems mittlerweile,gefunden wurden aber es geht.
Kathrin Altwegg 1:27:11
Mehr als viertausend planeten ja ja.
Tim Pritlove 1:27:13
In die tausende geht es so oder durchaus absehbar dass wir dann halt mit weiteren teleskopen noch verfeinert den techniken diese zahlen noch weiter nach oben bringen so dann wird das eine aufnahme eine interessante statistische masse auch an der man im prinzip diese chemischen modelle auch wiederum,dran kalibrieren kann oder müsste man.
Kathrin Altwegg 1:27:30
Uns ganz klar sein chemie bei diesen nächsten planeten es dann nochmal eine eine.
Tim Pritlove 1:27:43
Aber was kann man denn messen jetzt durch die exoten planeten,suche also welche informationen erhält man denn die man überhaupt chemisch anwende.
Kathrin Altwegg 1:27:51
Man man versucht man versucht die atmosphäre zu messen und jetzt gerade wieder war eine meldung dass man wasserdampf gefunden hat in einer atmosphäre,aber das ist schwierig weil die planeten sind in gottes namen klein,mit der distanz sie leuchten nicht es ist nicht ein stern oder sondern das ist etwas das nicht leuchtet aber meistens von etwas ist das sehr gut leuchtet,das ist so wie wenn sie neben kurz neben berlin eine kerze sehen müssen oder von weitem das sehen sie nicht nach berlin hell und dunkel.Und von daher gesehen ist also man kann es jetzt nur mit,indem man das licht der sterns hinten dran ist,beobachtet wenn die atmosphäre des planeten schon ein bisschen vor dem sterben ist,und anhand der linien die dann fehlen oder die man zusätzlich kann man etwas über dich sagen aber das ist noch extrem wenig.
Tim Pritlove 1:29:01
Ja also im prinzip dieselbe methode es jetzt hier gerade letzten folge die erkenntnis lage über pluto ist ja beim vorbei flug auch die atmosphäre genauso gemessen worden das kann man halt sehr eingeschränkt,machen das heißt darüber kann man erkenntnisse gewinnen die aber jetzt nicht ausreichend und dann wirklich alle fragen zu beantworten.
Kathrin Altwegg 1:29:23
Genau genau und dafür braucht man einfach um ein mehrfach das machen zu können.
Tim Pritlove 1:29:31
Ja jetzt wollt ich mal fragen was wäre denn sozusagen auf der wunschliste ja also wenn ich so wissenschaftler selber was äh so eine mission,wünschen dürften was was müsste die machen.
Kathrin Altwegg 1:29:43
Also für mich ist es ein kometen fan oder ich würde gerne noch einmal zu einem kometen gehen mit einem richtigen aufeinander,der absetzt der richtig tief bäumen kann und dann die zusammensetzung im inneren des kometen,ich glaube das wäre das wäre das richtige zu tun damit wir auch wieder unterscheiden kann was ist evolution und was ist vom anfang an da eben wie beim,ich meine es sogenannte wetter,im weltall erlebt sonnenwind kosmetische strahlung alles mögliche und dann müsste man dort auch tief gehen,aber selbst bei kometen oder wir haben starke geschichten so es wäre gut,richtig rein ein paar meter minimum hundert meter wäre noch besser,und wird besteht das ist im moment noch nicht ganz absehbar aber ich hoffe dass das irgendwie.

Tim Pritlove 1:30:56
Rosita die mission rosita eine wirklich außerordentlich,erfolgreiche mission obwohl er genau dieser teil mit dem länder so ein bisschen,schwierig war sag ich mal ja also es ist ja gelungen ihn landen zu lassen.Gerade dieses rein bohren hat dann nicht richtig funktioniert die haben nicht ausgelöst,dann hat man pech gehabt das ding ist irgendwie drei mal über die ganzen kometen rüber gehabt was interessante nebenbei erkenntnisse gebracht hat aber leider hat man sozusagen das eigentliche ziel allianzen lokal auf dem länderstationiert instrumente alle zum einsatz zu bringen nicht vollständig erreicht,könnte man natürlich sagen so ach ja nochmal zum kometen und so hat man ja schon aber ja gesehen dass eigentlich jetzt in dieser folge otto rosita dass all das wissen der vorherigen mission,extrem gut zum einsatz gebracht werden konnte und man sieht ja auch bei den problemen die nation heute haben um die zum mond zu fliegen das diese lange lange pause nach demapollo mission jetzt so gut auch nicht wahr weil irgendwo braucht man einfach die erfahrung und so auch ein bisschen das,spür der leute die sich schon vorher damit beschäftigt haben um sowas dann irgendwie auch erfolgreich zum einsatz zu bringen gibst gibt's denn sozusagen ein,was haben sie das gefühl dass es sozusagen eine ein zuspruch dafür geben könnte wenn man sagt ok wir machen jetzt aber nochmal komet weil komet können wir und diesmal stürzen wir uns sozusagen auf die nächsten und beantworteten fragen.
Kathrin Altwegg 1:32:33
Also die esa hat dieses jahr eine comedy mission ausgewählt kommentieren.Die ausgewählte wird im zwanzig achtundzwanzig starten zusammen mit daniel das ist eine extra planeten mission.Es ist eine sogenannte mission fast heißt auch billig.
Kathrin Altwegg 1:32:58
Muss billig sein ist ein bisschen ein ein atom,aber es ist eine lustige mission das wird ein ein space kraft sein das geht zuerst mal in den,orange punkt zwei dreht sondern gleich groß ist,und wir dort warten bis ein komet kommt von außen also vom direkt von rodewald zum ersten mal,einen sogenannten neuen kommen noch besser wenn von ganz außen konto wir hatten jetzt den,auch immer studierende,der kam ja von außen und das schöne wäre wenn so einer dann gerade kommt oder wenn wir dort sind und warten.
Tim Pritlove 1:33:47
Aber kann ja auch sein dass man erwartet was kommt nichts oder ist da so viel los das äh sehr.
Kathrin Altwegg 1:33:52
Es ist wahrscheinlich genug los dass einer kommt man kann nicht nur zwei drei jahre war,wenn man ihn dann kommen sie dann nichts wie los,das wird ein vorbeifahren geben wie bei,ein schneller vorbei flug dann wird's aber wir werden einen vergleich haben zum zürich eines neuen kometen oder eines extra solarium kometen mit,mit zürich.Das wird kommen hoffe dass dann später auch wieder eine große mission kommt eben mit einem land,der landet und nicht einfach runtergeworfen wird hoffnung sondern steht,und da kann man ganz ganz viele fragen beantworten.
Tim Pritlove 1:34:42
Wie viel besser ist denn das instrumentarium geworden im vergleich zu dort wo ich meine das jetzt äh fast vierzig jahre her.
Kathrin Altwegg 1:34:49
Also ich kann von unserem rosinen instrument massen spektrum meter mit einer auflösung von einem ganzen masse.Mit rosinen konnten wir einen neuen tausendsten auflösen auf der neuen tausendmal besser.War auch viel empfindlicher das instrument,und dann haben wir alle dass viele organische zeugs messen können oder und identifizieren können groß seitdem das war ja gebaut in den sechsundneunzig bis zweitausend,seitdem ist nicht mehr sehr viel passiert in massen sprechen.
Tim Pritlove 1:35:36
Aber es ist auch nicht das einzige instrument was eine rolle spielt oder doch.
Kathrin Altwegg 1:35:39
Nein aber das war war schon eines der schlüssel zum ende kameras die war sehr gut,das ist auch gut bei den maß mission bei den neuen maß missionen die wird immer besser dort spielt natürlich die,die computer hardware software eine große rolle für die kamera.Drängt pass ist.Dass die kamera auf jede menge daten erzeugen.
Tim Pritlove 1:36:11
Aber mehr als man.
Kathrin Altwegg 1:36:12
Viel mehr als man runter bekommt und die algorithmen um diese daten haben zum kopf premieren und sondern auszuscheiden das will ich das will ich nicht hängt natürlich mit guten rechenleistung zusammen.
Tim Pritlove 1:36:26
Und natürlich auch mit neuen algorithmen prinzip stehen wir so ein bisschen so an dem punkt wo man sagen muss wir müssen eigentlich bestimmte entscheidungen auf der,auf dem auf der sonne selbst fällen was man wegschmeißt und was man nicht wegschmeißt das natürlich knifflig ne.
Kathrin Altwegg 1:36:42
Ja das geht zusammen mit der maschine learning mit big data.Wenn man die rechten power hat auf dem spacex kraft dann kann man sehr viel machen und ich nehme an dort wird die entwicklung mehr vorwärts gehen als auf der eigentlichen sensor sein.
Tim Pritlove 1:37:01
Das problem mein maschine learning ist ja immer dass man eigentlich die maschinen das beibringt was man schon weiß und das ist eigentlich die eigentliche erkenntnisse aus den sachen kommen die man noch nicht wahr.
Kathrin Altwegg 1:37:10
Das ist gefährlich das ist vielleicht ein bisschen gefährlich aber ich muss sagen wir haben für china,aber zwei personen von,von berlin mathematiker haben sich dein problem angenommen und haben jetzt dank big data haben die sachen rausgeholt die wir nie rausgeholt hätten schließen da.
Tim Pritlove 1:37:37
Aber aus daten die gesendet wurden.
Kathrin Altwegg 1:37:39
Die gesendet worden aber das kann man im prinzip schon oben machen.
Tim Pritlove 1:37:44
Ja gut aber da kann man ja dann auch immer wieder immer wieder alle daten nehmen und gucken.
Kathrin Altwegg 1:37:50
Nein aber wenn sie's nicht runterkriegen die daten.
Tim Pritlove 1:37:52
Dann ist es die frage ob uns überhaupt sozusagen erhält oder nicht ja.
Kathrin Altwegg 1:37:57
Das ist das problem bei rosen hätten wir um möglich mehr daten runterkriegen können wir haben die voll ausgenutzt die daten.
Tim Pritlove 1:38:07
Das sind halt einfach die ganze zeit.
Kathrin Altwegg 1:38:08
Aber wenn wir jetzt ein instrument oder eine kamera mit besseren auflösung gehabt hätten.
Tim Pritlove 1:38:14
Wer gar kein platz mehr gewesen für die andere instrumente.
Kathrin Altwegg 1:38:16
Make-up pixel oder so etwas kamera.
Tim Pritlove 1:38:24
Das ist eigentlich gar nicht so viel.
Kathrin Altwegg 1:38:25
Heute haben wir das handy oder,das kriegen sie nicht mehr runter also müssen sie intelligent also ob man schon vorarbeiten.
Tim Pritlove 1:38:35
Ja und vor allem dann so eine suche wie wo ist denn viele so.
Kathrin Altwegg 1:38:38
Genau richtig ja ja ja ja ja ja.
Tim Pritlove 1:38:39
Das interessant gewesen wenn man das so algorithmus hätte lösen können.
Kathrin Altwegg 1:38:43
Also ich bin fast sicher am meisten wird in dieser beziehung gehen oder dass man sehr viel mehr umbaut macht und weniger von handel langsam.
Tim Pritlove 1:38:55
Das ist richtig forschungs- philosophische frage an der stelle sehe ich schon wieder so 'ne szene von zweitausendeins von meinem geistigen auge wo dann so der board computer selber darüber entscheidet was er den menschen mitzuteilen bereit ist das nicht.
Kathrin Altwegg 1:39:10
Es abgefahren oder man muss immer eingreifen können.
Tim Pritlove 1:39:17
Ja frau alt weg noch ein aspekt den wir noch kurz ansprechen sollten so zum abschluss ist tangieren was man mal so wissen bis.
Kathrin Altwegg 1:39:29
Nein haben wir viel viel erzählt.
Tim Pritlove 1:39:32
Das auf jeden fall ja gut dann sag ich vielen dank.
Kathrin Altwegg 1:39:37
Sie wollen mich noch fragen wie meine positionierung mein leben verändert hat.
Tim Pritlove 1:39:43
Das.
Kathrin Altwegg 1:39:45
Ich kann schon sagen seitdem funktioniert bin.
Tim Pritlove 1:39:48
Man kommt auch von dem thema nicht weg oder.
Kathrin Altwegg 1:39:54
Ja oder ich habe keine administration mehr ich mache keine leere mehr und jetzt kann ich effektiv forschung machen und das mache ich auch.
Tim Pritlove 1:40:04
Hält sie keiner zurück super,auch nicht mehr vielen dank für das gespräch und ja vielen dank fürs zuhören die über raum zeit das war's für heute und guten monat geht's dann wieder eine andere wunderbare welt der raumfahrt in.Bis dahin.
Shownotes
Organisation und Bedeutung der wissenschaftlichen Arbeit in der Raumstation
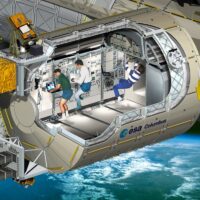 Die Internationale Raumstation umrundet die Erde alle 90 Minuten und ist für den kundigen Betrachter sogar regelmäßig mit bloßem Auge auszumachen — doch die tatsächliche Arbeit an Bord und ihre Bedeutung für die Wissenschaft bleibt dem einfachen Betrachter meist verborgen. Dabei spielt die ISS eine wichtige Rolle in der modernen Forschung und ist derzeit die einzige Möglichkeit, Langzeitforschung in der Schwerelosigkeit durchzuführen.
Die Internationale Raumstation umrundet die Erde alle 90 Minuten und ist für den kundigen Betrachter sogar regelmäßig mit bloßem Auge auszumachen — doch die tatsächliche Arbeit an Bord und ihre Bedeutung für die Wissenschaft bleibt dem einfachen Betrachter meist verborgen. Dabei spielt die ISS eine wichtige Rolle in der modernen Forschung und ist derzeit die einzige Möglichkeit, Langzeitforschung in der Schwerelosigkeit durchzuführen.
Dauer:
1 Stunde
51 Minuten
Aufnahme:
08.07.2013

Martin Zell
Abteilungsleiter für die Nutzung der ISS, ESTEC, ESA
|
Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Martin Zell — Abteilungsleiter für die Nutzung der ISS beim ESTEC und auch zuständig für das Astronautentraining am EAC – die Aspekte der wissenschaftlichen Planung, die Dimension und Bedeutung der Forschung an Board und welche neue Anwendungen die Raumstation künftig ermöglichen kann.
Shownotes
Themen
Begrüßung und Vorstellung — Aufgaben der ISS — Organisation und Finanzierung der ISS — Wissenschaft an Bord — Research Announcement — Forschungsgebiete — Medizinische Forschung — Biologische Forschung — Astrobiologie — Physik — Fundamentalphysik — Astrophysik — Grundlagenforschung — Biologische Experimente — Internationale Forschungsteams — Astronautentraining — Physik und Materialforschung — Langzeitexperimente — Kurzzeitexperimente — Astronautenzyklus — Bedeutung der ISS für die Forschung — Betriebsdauer und Ausbau der ISS — Die ISS und die Öffentlichkeit — Resümee und Ausblick
Das Weltraumteleskop zur Erforschung der Entstehung des Universums
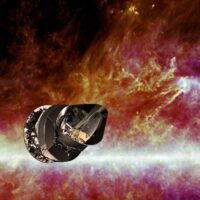 Das Planck-Weltraumteleskop ist ein ambitioniertes Projekt der ESA, das sich der Beobachtung der Kosmischen Hintergrundstrahlung verschrieben hat, die als Überbleibsel des Urknalls das erste zu beobachtende Ereignis des Universums ist.
Das Planck-Weltraumteleskop ist ein ambitioniertes Projekt der ESA, das sich der Beobachtung der Kosmischen Hintergrundstrahlung verschrieben hat, die als Überbleibsel des Urknalls das erste zu beobachtende Ereignis des Universums ist.
Das 13 Milliarden alte, ausgesprochen schwache Licht wird dabei aus allen Richtungen empfangen im Mikrowellenbereich empfangen. Durch massiv heruntergekühlte, langsam rotierende Instrumente gelang es Planck, eine hochauflösende, lückenlose Karte von der Entstehung unseres Universums zu erzeugen. 2013 konnte die 2009 in Betrieb gegangene Sonde ihren Auftrag erfolgreich abschließen.
Dauer:
1 Stunde
41 Minuten
Aufnahme:
05.06.2013

Nikolai von Krusenstiern
ESOC, ESA
|
Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Nikolai von Krusenstiern von den Anforderungen und Herausforderungen des Projekts, den bisherigen Erkenntnissen zum Urknall, die aufwändige Messung der Hintergrundstrahlung durch Planck, die komplizierte Bahnsteuerung und die geplante Inbetriebnahme, die ihre ganz eigenen Herausforderungen an das Team stellt.
Shownotes
Themen
Begrüßung und Vorstellung — Doppelmission Herschel-Planck — On-Board Software Maintenance — Der Urknall — Planck und die Hintergrundstrahlung — Die Planck-Instrumente — Raumfahrzeug und Flugbahnsteuerung — Datenübertragung — Missionsende — Den Satelliten aus dem Weg räumen — Sichere Abschaltung — Wissenschaftliche Ergebnisse
Konzept und die mögliche Realisierung des Weltraumbahnhofs des 21. Jahrhunderts
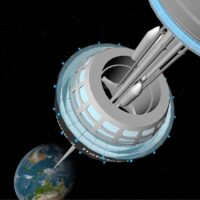 Die Raumfahrt stößt mit raketenbasierten Starts von Raumfahrzeugen auf große und bislang unüberwindliche Probleme. Um Orbits zu erreichen oder gar den Einfluss der Erdanziehung komplett zu verlassen ist der Anteil der Nutzlast bei dem tatsächlich beschleunigten Material nur sehr gering. Das macht die Raumfahrt teuer, aufwändig und gefährlich, setzt die Raumfahrzeuge schon beim Start großen Belastungen aus und wie auch viele gescheiterte Starts immer wieder gezeigt haben, sind hier dem Forschungstrieb der Menschheit große Grenzen gesetzt.
Die Raumfahrt stößt mit raketenbasierten Starts von Raumfahrzeugen auf große und bislang unüberwindliche Probleme. Um Orbits zu erreichen oder gar den Einfluss der Erdanziehung komplett zu verlassen ist der Anteil der Nutzlast bei dem tatsächlich beschleunigten Material nur sehr gering. Das macht die Raumfahrt teuer, aufwändig und gefährlich, setzt die Raumfahrzeuge schon beim Start großen Belastungen aus und wie auch viele gescheiterte Starts immer wieder gezeigt haben, sind hier dem Forschungstrieb der Menschheit große Grenzen gesetzt.
Doch eine Idee treibt die Wissenschaft von Anbeginn an um: was wäre, wenn man einen Fahrstuhl bauen könnte, der Material und Personen über ins All gespanntes Seil in die Höhe bringen könnte, das nur durch die Fliehkraft der Erde senkrecht über der Oberfläche steht? Die Beschränkungen der Raketenraumfahrt wären damit Geschichte, doch stellte das Konzept die Wissenschaft bislang noch vor unlösbare Herausforderungen.
Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels und es scheint, als ob wir uns einer Zeit nähern, in der die notwendigen Schlüsseltechnologien für einen Weltraumfahrstuhl langsam zusammen kommen. Dies würde dann in der Folge der Menschheit einen direkten Zugang zum All ermöglichen, die nahezu alle heutigen technischen Realitäten in eine neue Dimension überführen könnten.
Dauer:
1 Stunde
34 Minuten
Aufnahme:
05.06.2013

Markus Landgraf
ESOC, ESA
|
Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert ESA-Missionsanalyst Markus Landgraf den Stand der Technik, die noch erforderlichen technologischen Durchbrüche und die denkbaren Nutzungsszenarios eines Weltraumbahnhofs des 21. Jahrhunderts.
Shownotes
Themen
Intro — Vorstellung — Probleme der Raketenraumfahrt — Der Weltraumturm — Ein Seil aus dem Orbit — Ein Fahrstuhl ins All — Die Vision der Science Fiction — Das neue Material — Energie aus dem All — Fahrgeschwindigkeit — Inkrementeller Aufbau — Fahrstühle zu Bahnhöfen — Herausforderungen des Fahrstuhlbetriebs — Zerstörung des Seils — Wettereinflüsse — Bodenstation — Asteroiden — Internationale Aktivitäten — Zukünftige Nutzung
Per Infrarotstrahlung einen Blick in die entferntesten Ecken des Universums blicken
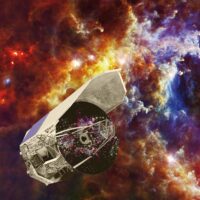 Das Infrarot-Weltraumteleskop Herschel wurde gemeinsam mit dem Schwester-Satelliten Planck 2009 gestartet und erreichte zwei Monate später seinen Aufenthaltspunkt auf der Erd-Sonnen-Achse ca. 1,5 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt. Von dort beobachtet Herschel den Weltraum im Infrarotteleskop mit dem größten Spiegel, der je von Menschen ins All gebracht wurde.
Das Infrarot-Weltraumteleskop Herschel wurde gemeinsam mit dem Schwester-Satelliten Planck 2009 gestartet und erreichte zwei Monate später seinen Aufenthaltspunkt auf der Erd-Sonnen-Achse ca. 1,5 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt. Von dort beobachtet Herschel den Weltraum im Infrarotteleskop mit dem größten Spiegel, der je von Menschen ins All gebracht wurde.
Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Micha Schmidt, Spacecraft Operations Manager beim ESOC in Darmstadt, die Technik des Satelliten und schildert die besonderen technischen Anforderungen, die für dieses Projekt beachtet werden mussten.
Dauer:
1 Stunde
49 Minuten
Aufnahme:
23.11.2011

Micha Schmidt
Spacecraft Operations Manager, ESOC, ESA
|
Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Micha Schmidt, Spacecraft Operations Manager beim ESOC in Darmstadt, die Technik des Satelliten und schildert die besonderen technischen Anforderungen, die für dieses Projekt beachtet werden mussten.
Themen: Überblick zu Herschel; Persönlicher Hintergrund; Testsatellit der TU-Berlin; Vorgängerprojekt ISO; Anforderungen an ein Infrarot-Weltraumtelskop; Sonnenkollektoren und -schutzschild; Temperatur-Einflüsse von Erde und Sonne; Die Langrange-Punkte und die optimale Wahl der Umlaufbahn; Abstrahlungsprinzip zur Wärmeableitung; Vorteile einer erdumlaufsynchrone Umlaufbahn für tägliche Kommunikation; Gründe für die Doppelmission mit Planck; Technische Synergien von Herschel und Planck; Kommunikation mit der Bodenstation; Aufbau und Komponenten von Herschel; Präzision und Funktionsweise des Lageregelungssystems; On-Board-Data-Handling; Energieerzeugung und -verbrauch; Kühlung der Komponenten schon vor dem Start; Sicherung der Temperatur durch Einschluss in Kühltank; Start von Herschel und Planck; Wissenschaftliche Forschung mit Herschel; Erfolg des Projekts.
Links:
Shownotes
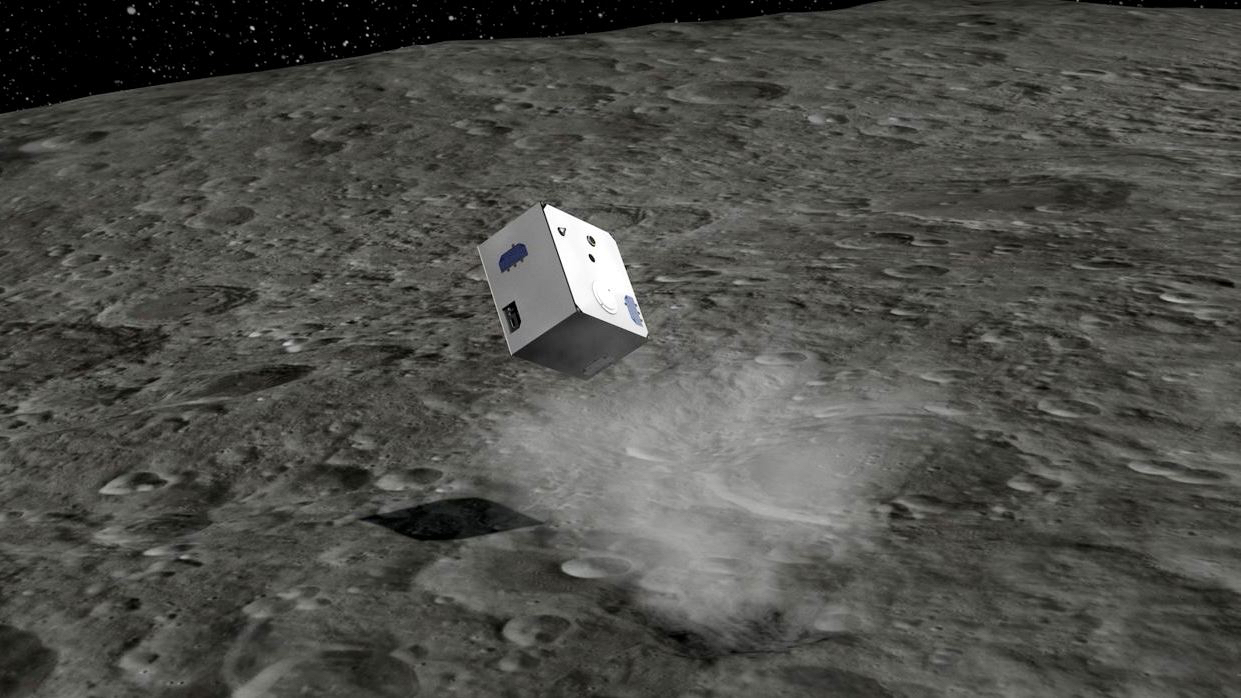

























































































































































































































































































































































































































DLR - Institut für Raumfahrtsysteme - Home
Hayabusa 2 – Wikipedia
Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum – Wikipedia
Guidance, navigation, and control - Wikipedia
ZARM – Wikipedia
Fallturm Bremen – Wikipedia
Meteor von Tscheljabinsk – Wikipedia
Tunguska-Ereignis – Wikipedia
RZ071 Asteroidenabwehr | Raumzeit
NEAR Shoemaker – Wikipedia
(433) Eros – Wikipedia
Rosetta (Sonde) – Wikipedia
(2867) Šteins – Wikipedia
(21) Lutetia – Wikipedia
Japan Aerospace Exploration Agency – Wikipedia
Hayabusa (Raumsonde) – Wikipedia
Micro/Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid – Wikipedia
Tschurjumow-Gerassimenko – Wikipedia
Asteroid – Wikipedia
Planetary Protection – Wikipedia
Hayabusa 2 – Wikipedia
(162173) Ryugu – Wikipedia
Internationale Astronomische Union – Wikipedia
Jet Propulsion Laboratory – Wikipedia
ESA Science & Technology - Marco Polo Mission Summary
Astronomische Einheit – Wikipedia
Endlicher Automat – Wikipedia
Gravitationskonstante – Wikipedia
Regolith – Wikipedia
OSIRIS-REx – Wikipedia
(101955) Bennu