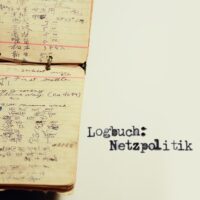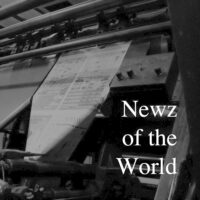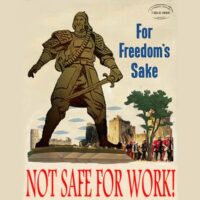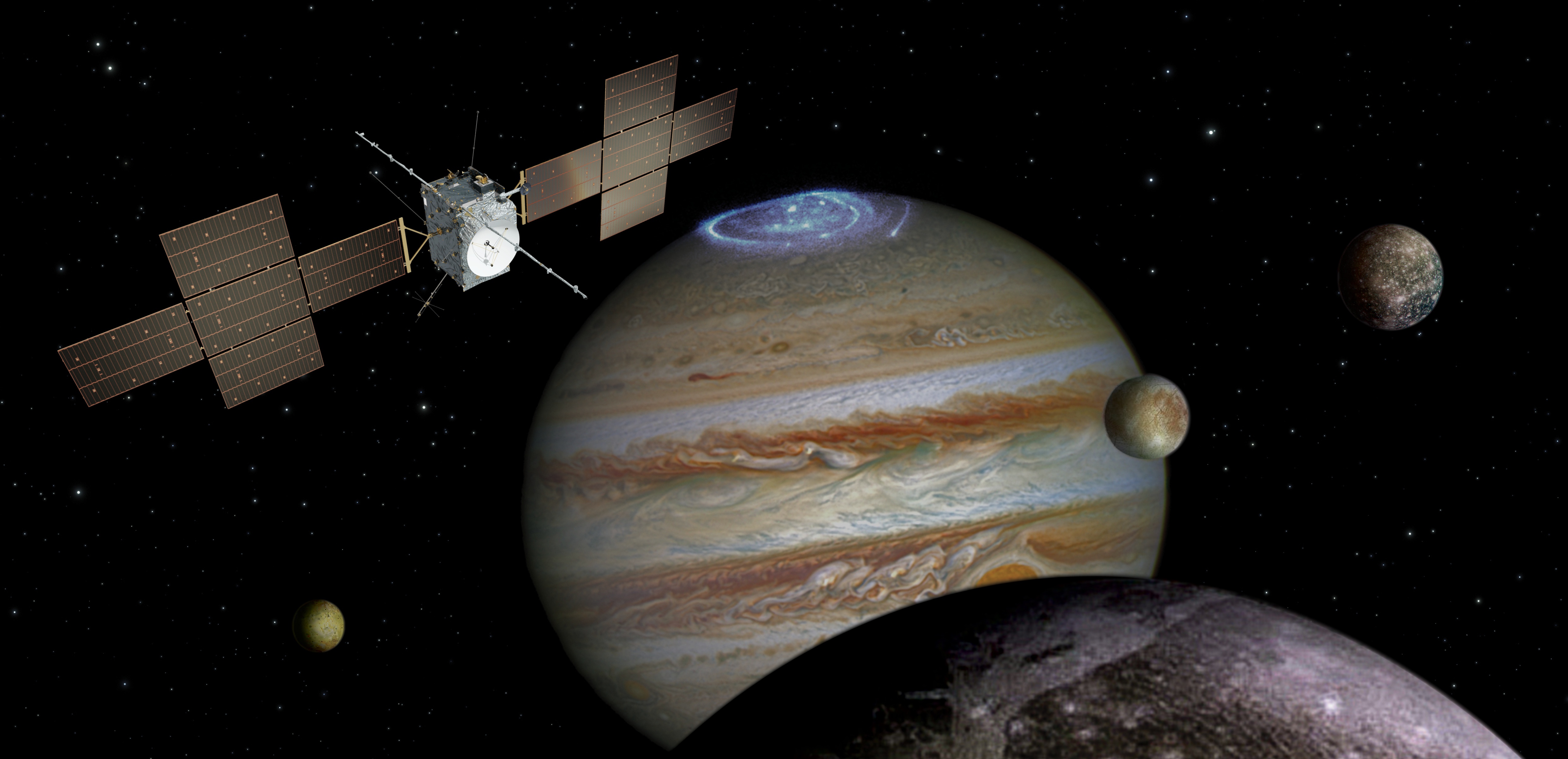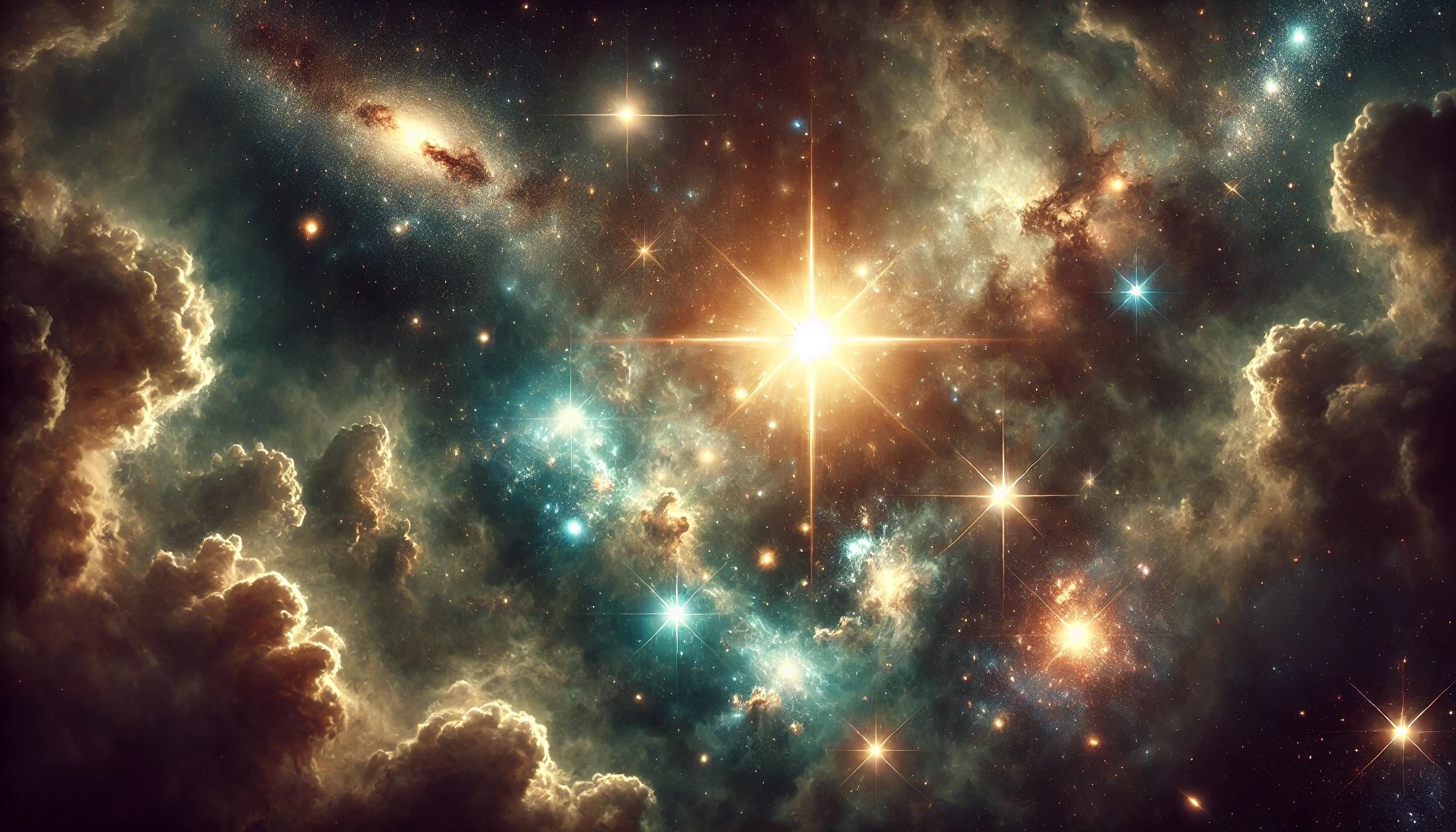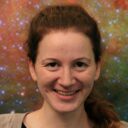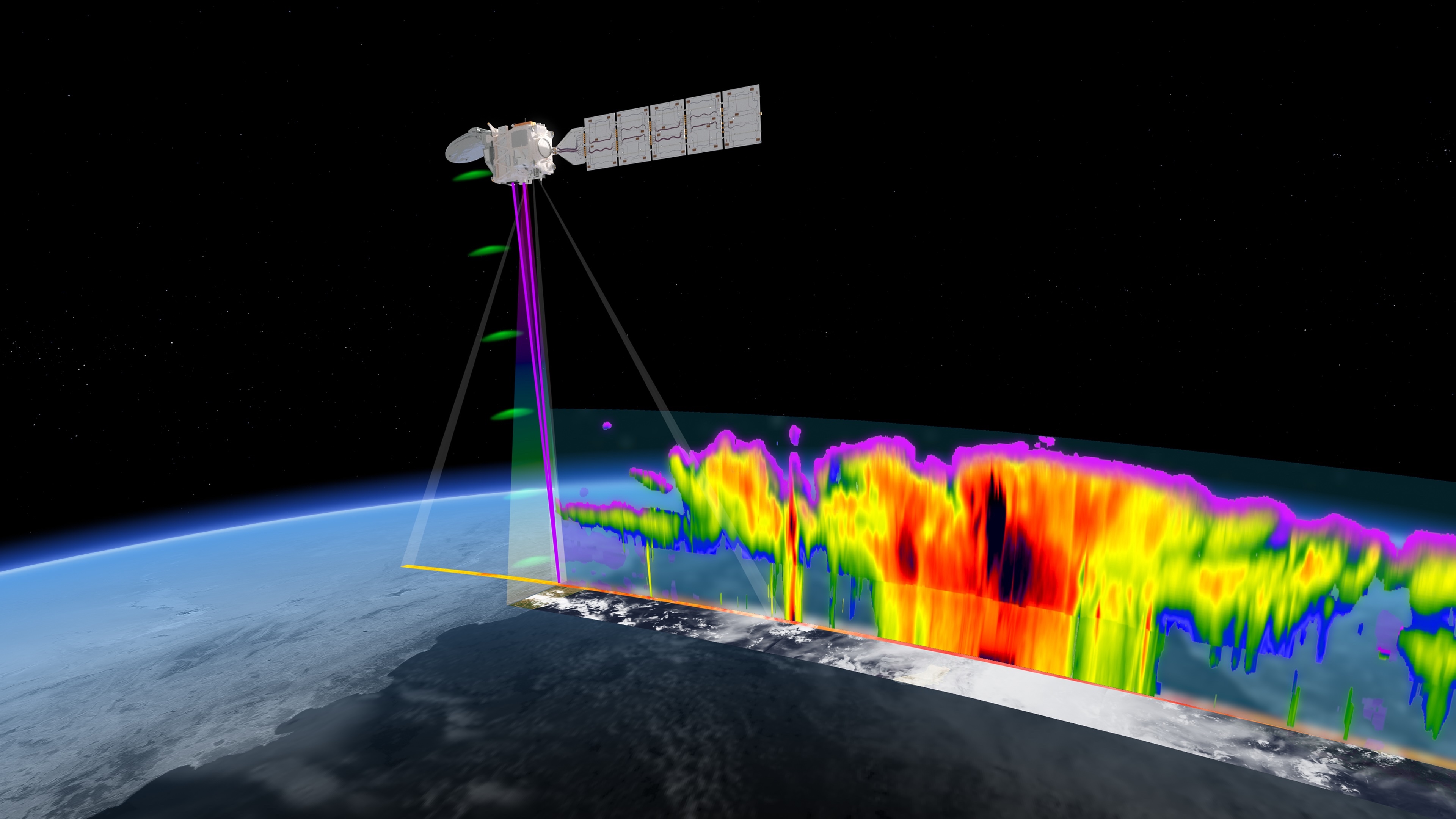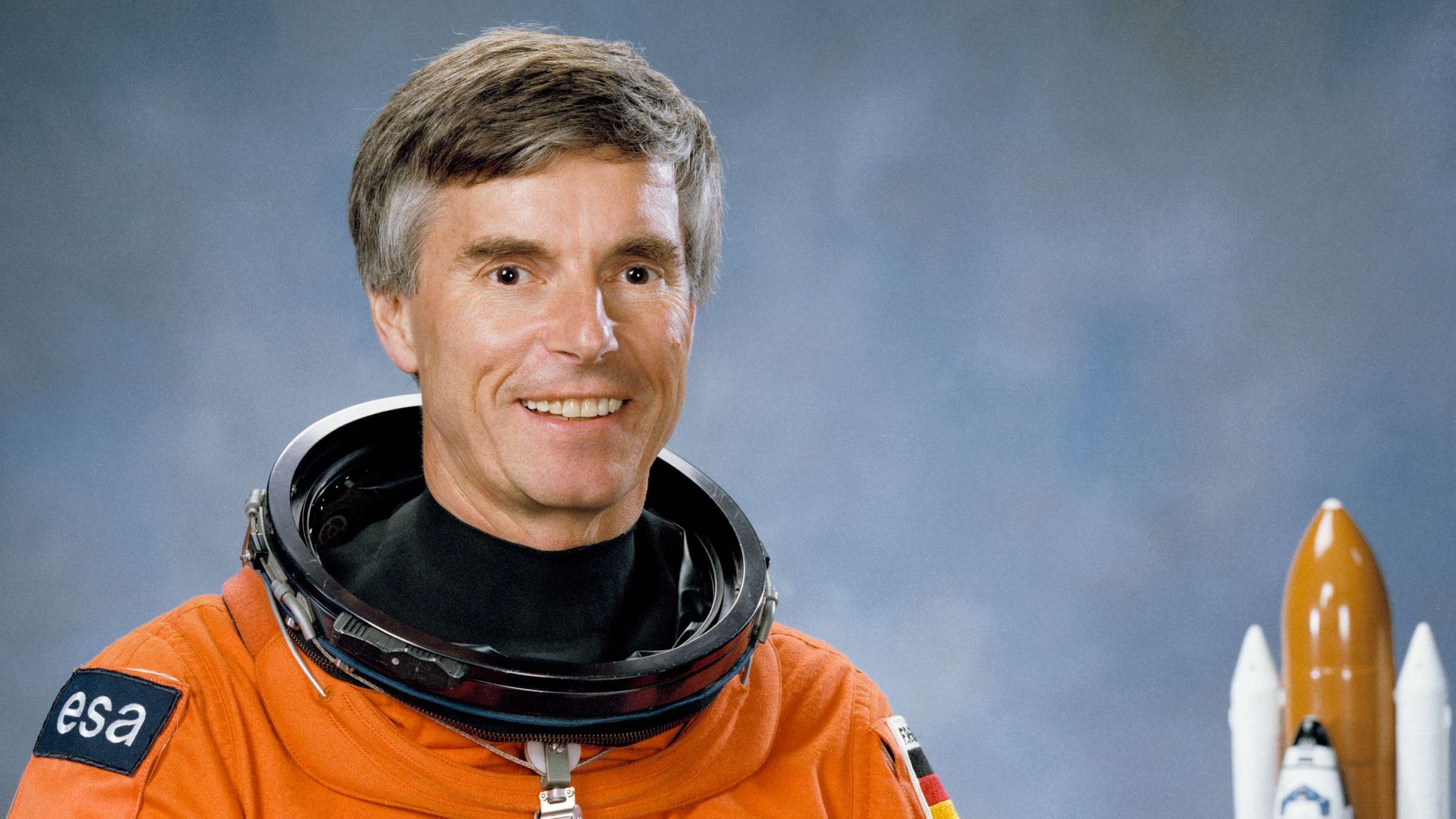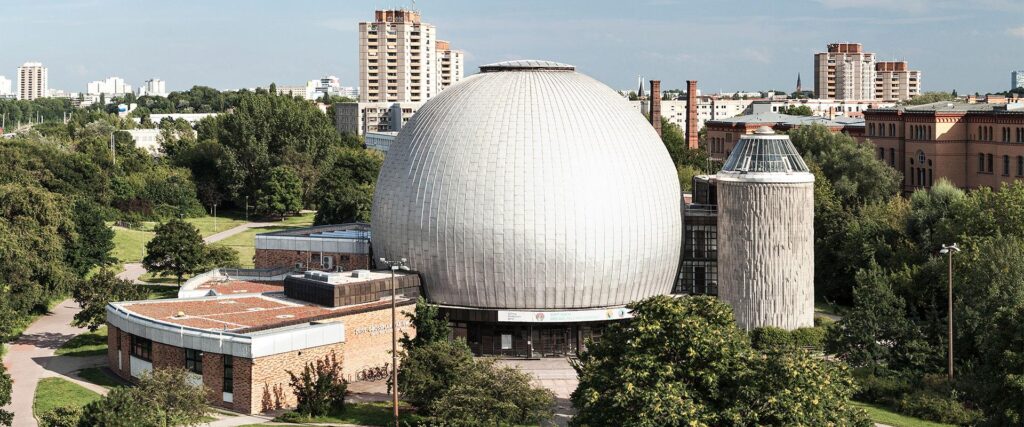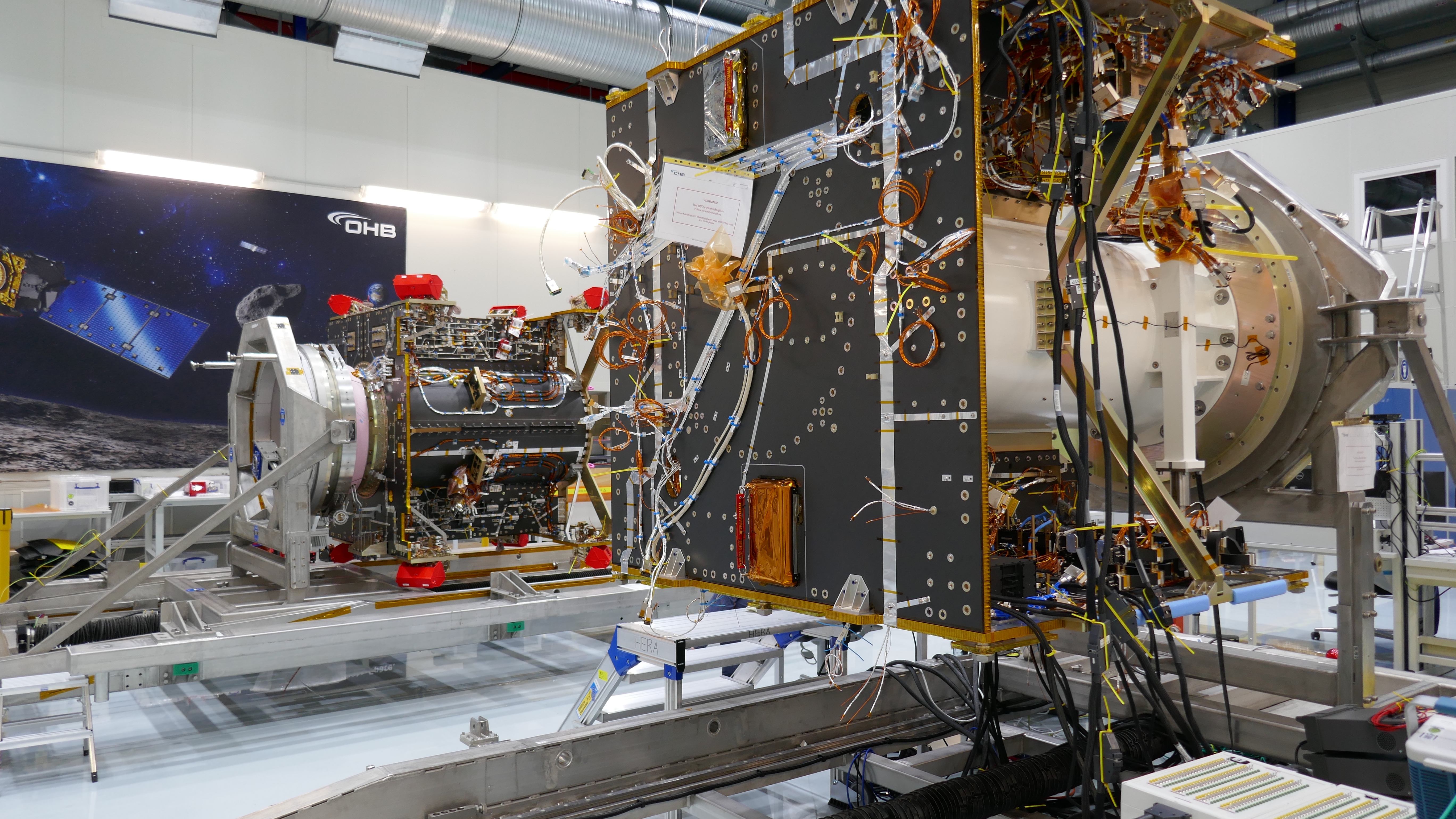In Chile entsteht das mit Abstand größte Bodenteleskop der Welt

Das Extremely Large Telescope ist der nächste große Schritt bei der bodengestützten Beobachtung des Weltalls und stellt dabei ganz neue Rekorde auf und dringt in Dimensionen vor, die uns bisher verborgen geblieben sind. So wird das Teleskop in der Lage sein einzelne Exoplaneten zu beobachten und verspricht durch seine feine Auflösung des Universums neue Erkenntnisse über viele offene Fragen.
Dauer:
Aufnahme:

Bertrand Koehler |
Ich spreche mit Bertrand Koehler vom European Southern Observatory (ESO), die für Planung, Bau und Betrieb des neuen Teleskops zuständig ist, das auf dem Cerro Armazones in der chileniischen Atacamawüste entsteht und in wenigen Jahren seine ersten Beobachtungen durchführen soll. Wir sprechen über die Anforderungen an die gigantischen Spiegel, die Instrumente und die wissenschaftlichen Ziele des Projekts.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Transkript





















































































































































































Shownotes
-
eso.org ESO
-
de.wikipedia.org La-Silla-Observatorium – Wikipedia
-
de.wikipedia.org Delay-Line-Interferometer – Wikipedia
-
en.wikipedia.org Very Large Telescope - Wikipedia
-
de.wikipedia.org Cerro Paranal – Wikipedia
-
en.wikipedia.org Diffraction-limited system - Wikipedia
-
en.wikipedia.org W. M. Keck Observatory - Wikipedia
-
de.wikipedia.org Normalverteilung – Wikipedia
-
de.wikipedia.org Zerodur – Wikipedia
-
de.wikipedia.org Schott AG – Wikipedia
-
de.wikipedia.org Heidenhain – Wikipedia
-
de.wikipedia.org Rotverschiebung – Wikipedia
-
de.wikipedia.org Exoplanet – Wikipedia
-
de.wikipedia.org Supernova – Wikipedia
-
de.wikipedia.org Dunkle Materie – Wikipedia
-
de.wikipedia.org Dunkle Energie – Wikipedia
-
de.wikipedia.org Quasar – Wikipedia
-
en.wikipedia.org Allan Sandage - Wikipedia
-
de.wikipedia.org Schwarzes Loch – Wikipedia
-
de.wikipedia.org Reinhard Genzel – Wikipedia
-
de.wikipedia.org Relativitätstheorie – Wikipedia