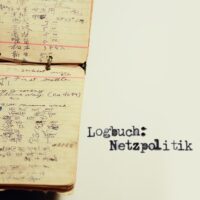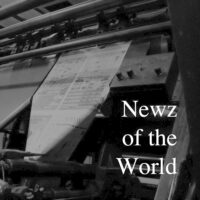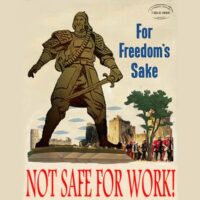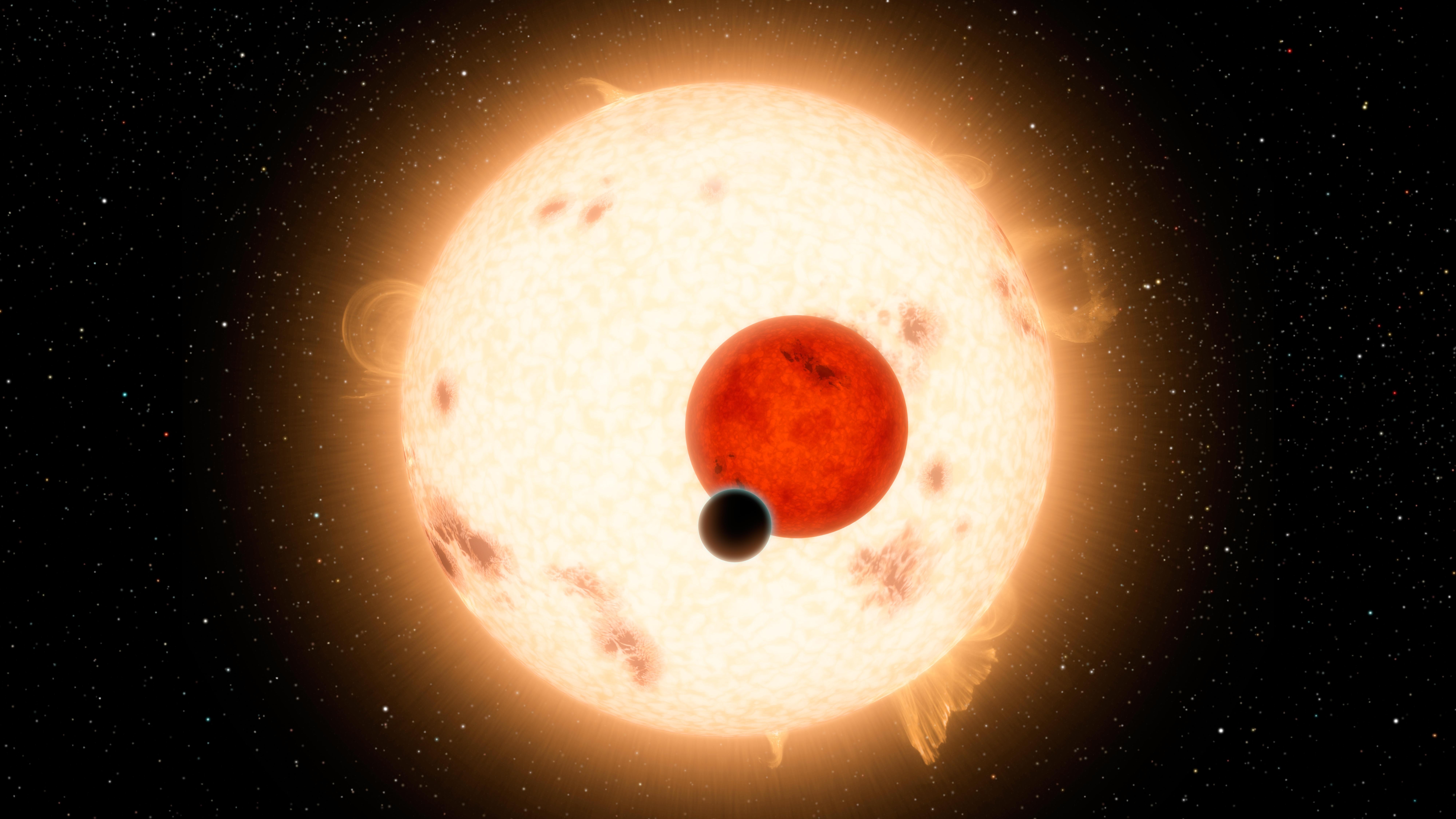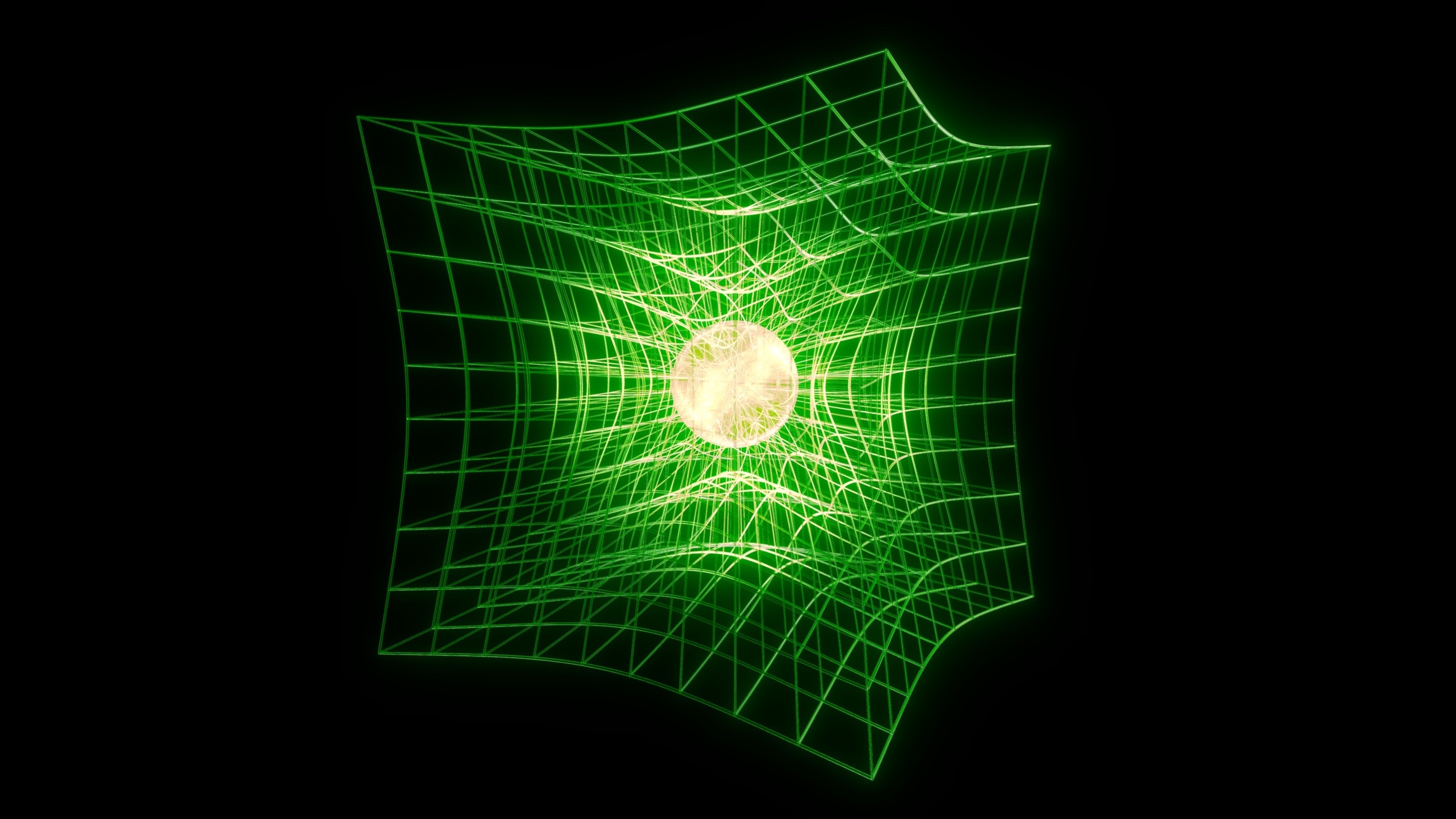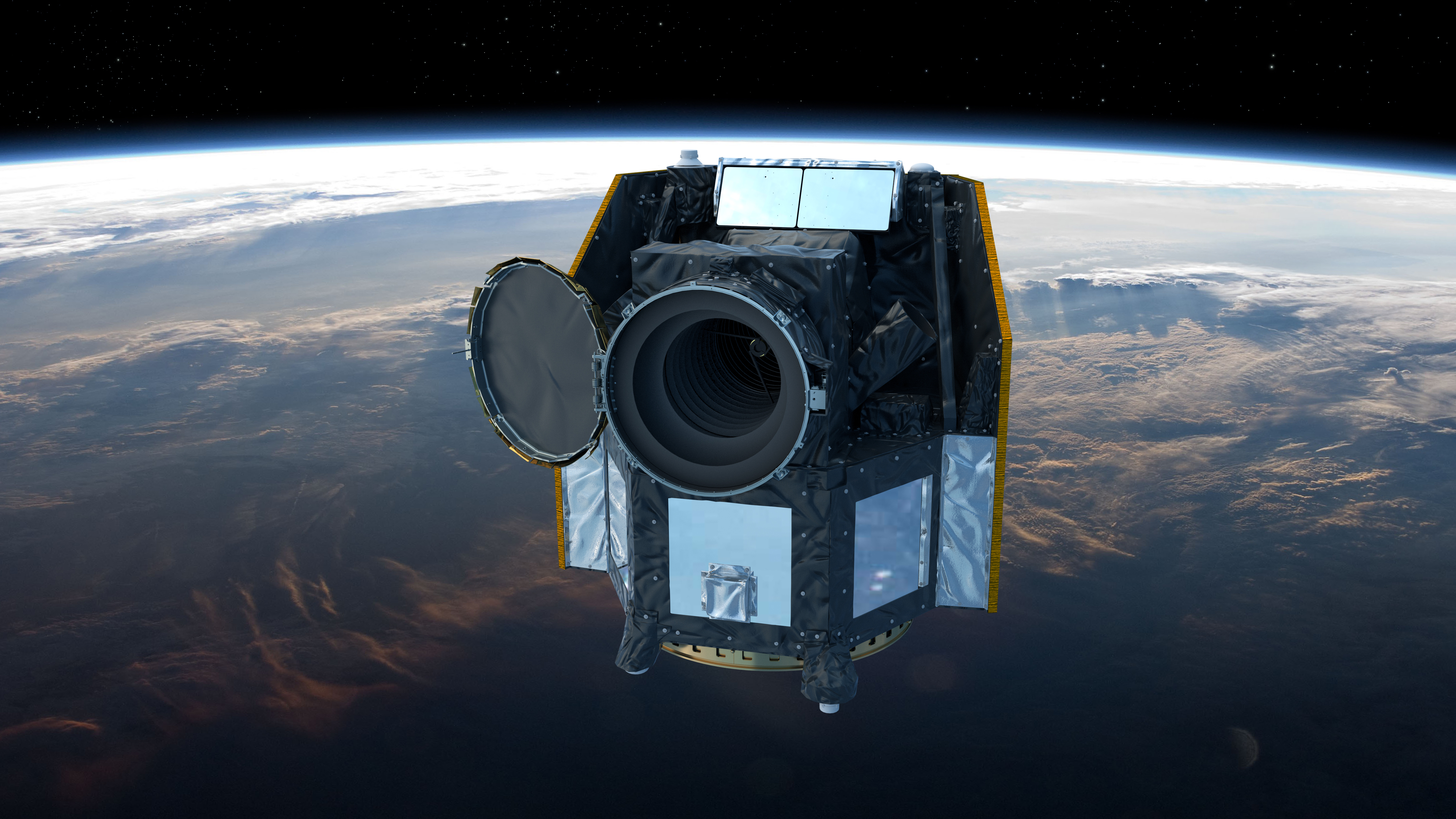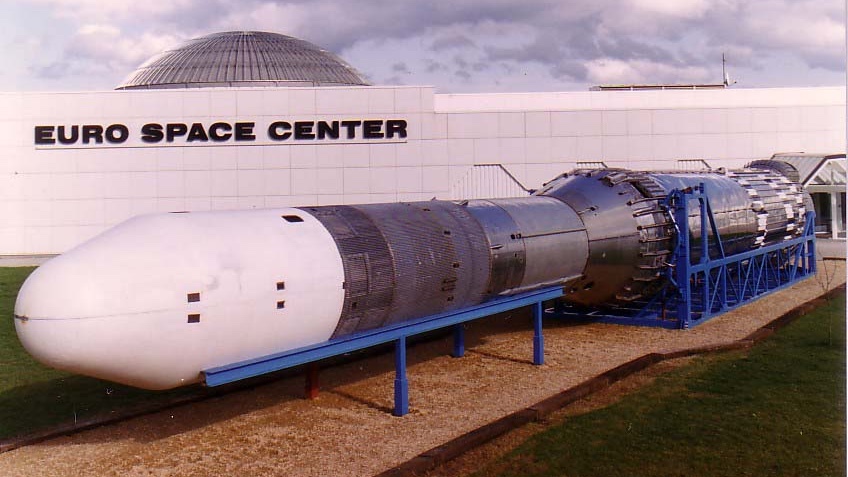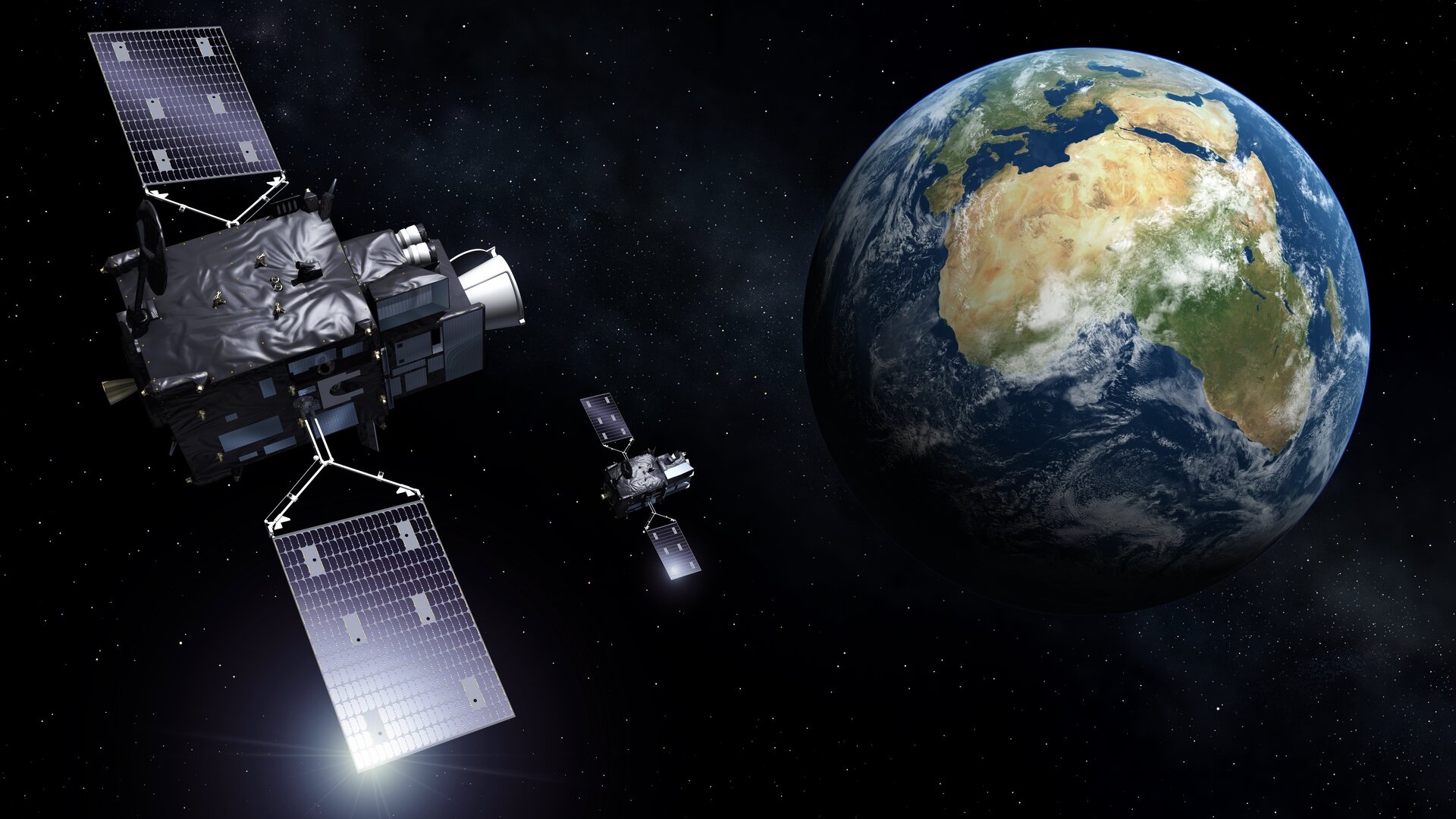Ein weiterer Blick auf Neutronensterne aus der Perspektive der Theoretischen Physik

Neutronensterne waren bei Raumzeit bereits ein Thema, jetzt wagen wir einen zweiten Aufschlag, da sich in diesem Feld in den letzten Jahren so einiges getan hat und neue Teleskop-Projekte sowie Forschungstechniken aufgerufen werden. Und insbesondere die direkte Beobachtung einer Kilonova, der Kollision zweier Neutronesterne, hat dieses Wissenschaftsgenre neu durchgemischt.
Dauer:
Aufnahme:

Vanessa Graber |
Ich spreche mit Vanessa Graber, theoretische Astrophysikerin und Spezialistin für Neutronenstern-Forschung am Institute of Space Sciences (CSIC) in Barcelona. Wir tauchen ein in die Geschichte und Theorie von Neutronensterne und erläutern die jüngsten Entdeckungen und Ereignisse und blicken zuletzt in die Zukunft eines „Raumzeit-GPS“, dass sich am Hintergrundrauschen der Gravitationsechos des Universums selbst orientiert.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Transkript































































































































































































































































Shownotes
Glossar
Suprafluidität – Wikipedia
Supraleiter – Wikipedia
Europäischer Forschungsrat – Wikipedia
Neutronenstern – Wikipedia
Walter Baade – Wikipedia
Fritz Zwicky – Wikipedia
Supernova – Wikipedia
Kernfusion – Wikipedia
Silicium – Wikipedia
Eisen – Wikipedia
Proton – Wikipedia
Neutron – Wikipedia
Elektron – Wikipedia
Neutrino – Wikipedia
Energieerhaltungssatz – Wikipedia
Kernphotoeffekt – Wikipedia
Jocelyn Bell Burnell – Wikipedia
Elektromagnetische Störung – Wikipedia
Pulsar – Wikipedia
PSR J1921+2153 – Wikipedia
Schwarzes Loch – Wikipedia
Einsteinsche Feldgleichungen – Wikipedia
Weißer Zwerg – Wikipedia
Erhaltungssatz – Wikipedia
Drehimpuls – Wikipedia
Krebsnebel – Wikipedia
PSR J0835-4510 – Wikipedia
Standardkerze – Wikipedia
Magnetischer Fluss – Wikipedia
Weißer Zwerg – Wikipedia
Maxwell-Gleichungen – Wikipedia
Dipol (Physik) – Wikipedia
LIGO – Wikipedia
Zustandsgleichung – Wikipedia
PSR J1915+1606 – Wikipedia
Raumzeit – Wikipedia
Virgo (Gravitationswellendetektor) – Wikipedia
Gammablitz – Wikipedia
Fermi Gamma-ray Space Telescope – Wikipedia
Kilonova – Wikipedia
Square Kilometre Array – Wikipedia
Pulsar timing array - Wikipedia
Global Positioning System - Wikipedia
Magellansche Wolken – Wikipedia
Wolfram Alpha – Wikipedia
Sternsensor – Wikipedia
Voyager Golden Record – Wikipedia
Stringtheorie – Wikipedia
Inflation (Kosmologie) – Wikipedia